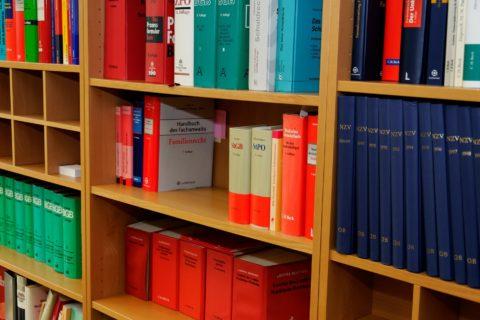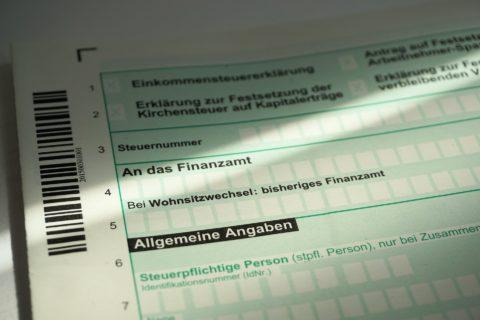Die Höhe der Minderung bestimmt sich bei Werkverträgen nach der Vorschrift des § 638 Abs. 3 BGB. Danach ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

Bei Mängeln eines Bauwerks kann es im Hinblick auf die sogenannte Erfolgshaftung des Werkunternehmers angebracht sein, hinsichtlich der Höhe der Minderung auf die Kosten abzustellen, die zur Beseitigung eines Mangels erforderlich sind.
Die Berechnung der Minderung nach den Kosten der Mangelbeseitigung bzw. Nacherfüllung ist jedoch in den Fällen nicht möglich, in denen die Mangelbeseitigung nicht durchführbar oder gemäß § 635 Abs. 3 BGB unverhältnismäßig ist. Die Höhe der Minderung kann aber auch dann geringer sein, wenn zwar die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 BGB nicht unverhältnismäßig gewesen wäre, jedoch im Einzelfall die Herabsetzung der Vergütung um die vollen Nacherfüllungskosten in einem auffälligen Missverhältnis zum Gesamtwert stünde und daher unverhältnismäßig erscheint. Dabei sind stets auch die Grundsätze von Treu und Glauben zu beachten, die ggf. bereits der Ausübung eines Gewährleistungsrechts überhaupt entgegen stehen können. In den vorgenannten Fällen kommt die Berücksichtigung eines etwaigen technischen oder merkantilen Minderwerts in Betracht.
Ob bereits eine Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 BGB als unverhältnismäßig anzusehen gewesen wäre und schon aus diesem Grunde eine Bemessung der Minderung nach den (erheblichen) Nacherfüllungskosten ausscheidet, weil der Mangel weder eine Beeinträchtigung der Funktions- oder Gebrauchstauglichkeit des Bodens noch der Optik zur Folge hat, kann dahinstehen. Jedenfalls erscheint eine entsprechende Herabsetzung der Vergütung des Unternehmers unverhältnismäßig, da sein Werklohn auf Null gemindert würde, die Besteller jedoch einen dauerhaft gebrauchs- und voll funktionsfähigen Boden behalten könnten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Störung des Nutzungsempfindens der Besteller durch die Hohlstellen allenfalls als verhältnismäßig geringfügig einzustufen ist. Abgesehen davon, dass die Hohlstellen überwiegend in den Randbereichen vorhanden sind, die normalerweise – auch mit einem Rollstuhl – kaum beansprucht werden, haben die Kläger selbst weder behauptet noch näher dargelegt, dass sie das Parkett mit Stöckelschuhen begehen oder sonst mit Gegenständen nutzen, bei denen die Hohlstellen in ähnlich störender Weise hörbar sind. Schließlich spricht gegen eine fortdauernde erhebliche Beeinträchtigung auch der Umstand, dass die Besteller mit der Klage von Anfang an vom Unternehmer weder Schadensersatz durch Austausch des Parkettbodens noch – anders als in dem Fall OLG Köln IBR 2010, 617 – (Vorschuss für) die Kosten einer entsprechenden Selbstvornahme der Mangelbeseitigung verlangt, sondern sich auf die Geltendmachung einer Minderung beschränkt haben.
Nach allem können die Besteller, da ein technischer Minderwert nicht feststellbar ist, lediglich eine Minderung für einen merkantilen Minderwert verlangen. Dieser liegt vor, wenn die vertragswidrige Ausführung im Vergleich zur vertragsgemäßen eine verringerte Verwertbarkeit zur Folge hat, weil die maßgeblichen Verkehrskreise ein im Vergleich zur vertragsgemäßen Ausführung geringeres Vertrauen in die Qualität des Gebäudes haben.
Landgericht Heidelberg – Urteil vom 7. November 2013 – 3 O 342/12