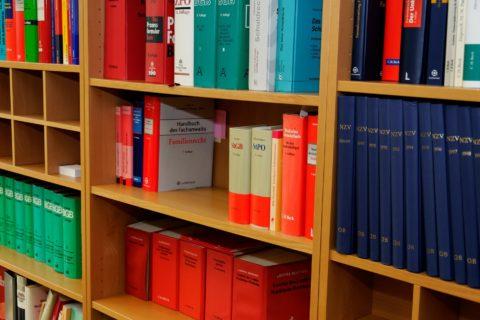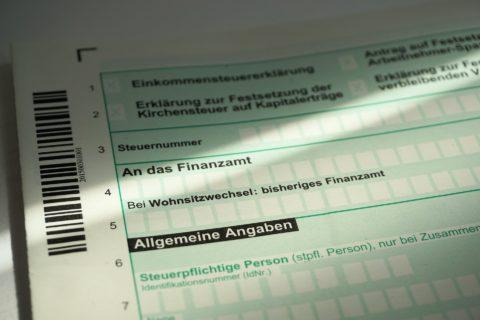Die entgeltliche Garantiezusage des Kfz-Händlers ist keine unselbständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigenständige Leistung. Mit einer Garantiezusage, durch die der Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im Garantiefall eine Geldleistung verspricht, liegt eine Leistung aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des VersStG vor, die nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG steuerfrei ist.

Die Umsätze aus den Garantiezusagen einer Kfz-Händlerin sind umsatzsteuerfrei.
Garantiezusage als eigenständige Leistung[↑]
Die entgeltliche Garantiezusage der Kfz-Händlerin stellt keine unselbständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigenständige Leistung dar.
Eine Leistung ist dann als Nebenleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie für den Leistungsempfänger keinen eigenen Zweck, sondern das Mittel darstellt, um die Hauptleistung des Leistenden unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen[1].
Jeder Versicherungsumsatz weist naturgemäß eine Verbindung zu dem Gegenstand auf, der damit versichert wird. Diese Verbindung kann jedoch für sich genommen nicht zur Klärung der Frage ausreichen, ob umsatzsteuerrechtlich eine einheitliche zusammengesetzte Leistung vorliegt. Wäre für die Umsatzsteuerpflicht jedes Versicherungsumsatzes maßgebend, ob Leistungen, die sich auf den versicherten Gegenstand beziehen, dieser Steuer unterliegen, würde nämlich der Zweck von Art. 135 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL; ehemals: Art. 13 Teil B Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern), die Befreiung der Versicherungsumsätze, in Frage gestellt[2].
Im vorliegenden Fall ist die Garantiezusage nicht lediglich eine Nebenleistung zum Fahrzeugverkauf; vielmehr hat die rückversicherte Garantieleistung des Verkäufers neben der Fahrzeuglieferung einen eigenen Zweck, so dass es sich um jeweils selbständige Leistungen handelt[3].
Selbständige Garantiezusage als Kostenübernahmeversprechen[↑]
Entgegen der Würdigung des Niedersächsischen Finanzgerichts[4] in der Vorinstanz handelt es sich bei der im Streitfall vorliegenden selbständigen Garantiezusage nicht um ein Leistungsbündel, das durch das Versprechen der Einstandspflicht des Händlers geprägt ist, sondern lediglich um das Versprechen der Kostenübernahme im Garantiefall.
Zwar ist das Finanzgericht davon ausgegangen, dass der Garantienehmer aufgrund der Garantiezusage wählen könne, ob er die Reparatur durch seinen Händler ausführen lässt (Reparaturanspruch) oder ob er den durch den Händler darüber hinaus verschafften Versicherungsschutz in Anspruch nimmt und die Reparatur durch eine andere Werkstatt vornehmen lässt (Reparaturkostenersatzanspruch). Dies ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.
Zum Bereich der tatsächlichen Würdigung des Finanzgericht, an die der Bundesfinanzhof gemäß § 118 Abs. 2 FGO grundsätzlich gebunden ist, gehört auch die Auslegung von Verträgen[5].
Die vorinstanzliche Sachverhaltswürdigung bindet den Bundesfinanzhof jedoch nur, wenn sie frei von Verfahrensfehlern ist und weder Widersprüche noch einen Verstoß gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze enthält und die Vertragsauslegung nach den Grundsätzen der §§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zumindest möglich ist[6].
Im vorliegenden Fall ist die Sachverhaltswürdigung des Finanzgericht insoweit widersprüchlich und verstößt gegen Denkgesetze, als es zunächst feststellt, dass es sich bei der von der Kfz-Händlerin gewährten Garantie um eine unselbständige Nebenleistung zum Gebrauchtwagenkauf handele, im Folgenden jedoch feststellt, dass es sich bei der Garantiezusage um eine (selbständige) sonstige Leistung eigener Art handele.
Unabhängig davon widerspricht die vom Finanzgericht vorgenommene Auslegung dem Vertragswortlaut und ist auch nicht durch weitere Begleitumstände gerechtfertigt.
Was Leistungsgegenstand der Garantie ist, ist Art. 9 der Garantiebedingungen („Reparaturumfang“) zu entnehmen. Danach wird im Garantiefall Ersatz für die erforderlichen Kosten einer Reparatur geleistet und im Weiteren die Höhe der Kostenerstattung eingeschränkt. Eine Sachleistungspflicht des Händlers ergibt sich hieraus nicht. Vielmehr würde bei Abwicklung über den Händler (vgl. Art. 7 der Garantiebedingungen) der Zahlungsanspruch des Händlers aufgrund der Reparatur mit dem Kostenerstattungsanspruch des Versicherungsnehmers -unter Berücksichtigung etwaiger Selbstbehalte- aufgerechnet.
Etwas anderes folgt nicht aus Art. 7 Nr. 2 der Garantiebedingungen. Unter der Überschrift: „Abwicklung im Garantiefall“ war in Art. 7 Nr. 1 der Garantiebedingungen geregelt, dass nach Meldung des Schadensfalls den Weisungen des Händlers (der Kfz-Händlerin) bzw. des mit der Abwicklung beauftragten Rückversicherers zu folgen war. In diesem Zusammenhang steht die Regelung in Art. 7 Nr. 2 der Garantiebedingungen, wonach die Reparatur durch den Garantiegeber oder einen anderen Kfz-Meisterbetrieb durchgeführt wird, wobei vorrangig ein geeigneter Reparaturbetrieb aus dem X-Service Netzwerk gewählt werden sollte.
Zwar besteht bei Vorliegen der Voraussetzungen eines Gewährleistungsanspruchs im Ergebnis für den Kunden ein Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung/Reparatur durch den Verkäufer und Inanspruchnahme der Reparaturkostenerstattung.
Beide Ansprüche ergeben sich jedoch aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen: Der Mängelbeseitigungsanspruch ergibt sich aus der Pflicht zur Sachmängelgewährleistung nach §§ 437, 434 BGB aufgrund des (selbständigen) Kaufvertrags. Voraussetzung ist, dass der Mangel bei Übergabe vorlag (auch wenn dies innerhalb der ersten sechs Monate gemäß § 476 BGB beim hier vorliegenden Verbrauchsgüterkauf vermutet wird), es sich insofern nicht um einen Verschleißschaden handelt und dem Verkäufer grundsätzlich nach §§ 437 Nr. 1, 439 BGB zunächst die Möglichkeit zur Nacherfüllung eingeräumt wurde. Dagegen ergibt sich der Anspruch auf Reparaturkostenerstattung (eingeschränkt durch einen etwaigen Selbstbehalt) aus dem Garantievertrag immer, wenn der Mangel in der Garantiezeit auftritt. Ohne vorherige Aufforderung zur Nacherfüllung (nach Anzeige des Schadens und ggf. Einholung eines Kostenvoranschlags) kann eine Werkstatt -nach den Weisungen des Garantiegebers- mit der Reparatur beauftragt werden.
Da Inhalt der Garantie somit ausschließlich die Leistung von Kostenersatz durch den Garantiegeber ist, kommt es auf die Bestimmung eines prägenden Leistungsbestandteils im vorliegenden Fall mangels Leistungsbündels nicht an. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall auch wesentlich von dem Fall, der der Entscheidung des Bundesfinanzhofs in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109 zu Grunde lag. Denn danach hatte der Garantienehmer im Garantiefall ein Wahlrecht zwischen Sachleistung/Reparatur durch den Händler oder Geldleistung direkt gegenüber der Versicherung[7].
Umsatzsteuerfreiheit der Garantiezusage[↑]
Die Steuerfreiheit der mit der Garantiezusage gewährten Leistung der Kfz-Händlerin ergibt sich zumindest nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG.
Nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG sind die Leistungen aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des Versicherungsteuergesetzes (VersStG) steuerfrei; das gilt auch, wenn die Zahlung des Versicherungsentgelts nicht der Versicherungsteuer unterliegt.
Unter dem Versicherungsverhältnis im Sinne des VersStG ist das durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandene Rechtsverhältnis des einzelnen Versicherungsnehmers zum Versicherer und seine Wirkungen zu verstehen. Wesentliches Merkmal für ein Versicherungsverhältnis i.S. des § 1 Abs. 1 VersStG ist das Vorhandensein eines vom Versicherer gegen Entgelt übernommenen Wagnisses[8].
Grundlage der in § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG normierten Befreiung ist Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL. Danach befreien die Mitgliedstaaten Versicherungs- und Rückversicherungsumsätze einschließlich der dazugehörigen Dienstleistungen, die von Versicherungsmaklern und -vertretern erbracht werden, von der Steuer.
Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL definiert den Begriff „Versicherungsumsätze“ nicht. Jedoch besteht das Wesen eines Versicherungsumsatzes darin, dass der Versicherer sich verpflichtet, dem Versicherten gegen vorherige Zahlung einer Prämie im Fall der Verwirklichung des abgedeckten Risikos die bei Vertragsschluss vereinbarte Leistung zu erbringen[9].
Ein Versicherungsumsatz setzt demnach sowohl nach nationalem Recht als auch nach Unionsrecht eine Vertragsbeziehung zwischen dem Erbringer der Versicherungsdienstleistung und der Person, deren Risiken von der Versicherung gedeckt werden, d.h. dem Versicherten, voraus[10]. Die Leistung, zu deren Erbringung im Versicherungsfall der Versicherer sich verpflichtet, braucht nicht in der Zahlung eines Geldbetrags, sondern kann auch in Beistandsleistungen entweder durch Geldzahlung oder Sachleistungen bestehen[11].
Mit der Garantiezusage, durch die die Kfz-Händlerin im Garantiefall eine Geldleistung versprochen hat, liegt eine Leistung aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des VersStG i.S. des § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG vor.
Versicherter und gleichzeitig Versicherungsnehmer ist der Käufer des Fahrzeugs.
Versicherer ist hier der Gebrauchtwagenverkäufer, die Kfz-Händlerin, mit der der Versicherte eine direkte Vertragsbeziehung hat. Denn anders als nach dem Sachverhalt in der Entscheidung „Mapfre asistencia und Mapfre warranty“[12] und den durch BFH, Urteile in BFHE 200, 126, BStBl II 2003, 378, in BFH/NV 2003, 669 und in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109 entschiedenen Fällen, wurde durch die vorliegende Garantiezusage nach den Feststellungen des Finanzgericht dem Garantienehmer kein direkter Anspruch gegenüber dem (Rück-)Versicherer, X, eingeräumt.
Dies gilt unabhängig davon, dass die Kfz-Händlerin bei einem Versicherer rückversichert war. Denn der Umsatz zwischen einem Unternehmer und seinem Kunden beurteilt sich nach dem Rechtsgeschäft, das zwischen diesen abgeschlossen worden ist, und nicht danach, ob der Unternehmer für seine Verpflichtung aus diesem Rechtsgeschäft -wie hier- eine Rückversicherung abgeschlossen hat[13].
Das übernommene fremde Risiko bzw. Wagnis besteht in den dem Käufer im Fall eines von der Garantie erfassten Defekts entstehenden Reparaturkosten. Dieses Risiko hat die Kfz-Händlerin insoweit übernommen, als sie aufgrund der Garantie zu Kostenersatz verpflichtet ist.
Dem steht nicht entgegen, dass die Kfz-Händlerin als Gebrauchtwagenhändlerin kein der Versicherungsaufsicht unterliegendes Versicherungsunternehmen ist.
Versicherer im Sinne der Versicherungsteuer sind zwar in erster Linie die der Versicherungsaufsicht unterliegenden Versicherungsunternehmen. Für die Steuerfreiheit ist aber unerheblich, ob der Versicherer die nach nationalem Recht erforderliche Zulassung besitzt[14].
Dieses Ergebnis entspricht auch dem Normzweck. Durch die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 10 UStG soll eine doppelte Belastung des Versicherten mit Versicherungsteuer und Umsatzsteuer vermieden werden[15].
Die von der Kfz-Händlerin erhaltenen Entgelte umfassen die Versicherungsprämie und damit auch die darin enthaltene Versicherungsteuer. Damit sind die Kunden (Versicherungsnehmer) mit der Versicherungsteuer belastet. Es würde deshalb dem Sinn des § 4 Nr. 10 UStG widersprechen, wenn die Verschaffung des Versicherungsschutzes zusätzlich umsatzsteuerpflichtig wäre. Dies gilt umso mehr, als die Reparaturleistungen im Versicherungsfall, die von der Kfz-Händlerin bezahlt werden, ihrerseits umsatzsteuerpflichtig sind[16].
Bundesfinanzhof, Urteil vom 14. November 2018 – XI R 16/17
- ständige Rechtsprechung, vgl. EuGH, Urteile CPP vom 25.02.1999 – C-349/96, EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 30; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 54; BFH, Urteile vom 24.04.2013 – XI R 7/11, BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 61; vom 27.02.2014 – V R 14/13, BFHE 245, 272, BStBl II 2014, 869, Rz 20; jeweils m.w.N.; vom 01.03.2016 – XI R 11/14, BFHE 253, 438, BStBl II 2016, 753, Rz 20[↩]
- vgl. EuGH, Urteile BGZ Leasing, EU:C:2013:15, HFR 2013, 270, Rz 36; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 51[↩]
- vgl. BFH, Urteile vom 09.10.2002 – V R 67/01, BFHE 200, 126, BStBl II 2003, 378, unter II. 2., Rz 32 ff.; vom 16.01.2003 – V R 16/02, BFHE 201, 343, BStBl II 2003, 445; vom 30.01.2003 – V R 13/02, BFH/NV 2003, 669; vom 10.02.2010 – XI R 49/07, BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 17; Abschn.03.10 Abs. 6 Nr. 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses[↩]
- Nds. FG, Urteil vom 23.02.2017 – 11 K 134/16[↩]
- vgl. BFH, Urteile vom 18.01.2005 – V R 17/02, BFH/NV 2005, 1394; in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 33; vom 28.08.2013 – XI R 4/11, BFHE 243, 41, BStBl II 2014, 282; vom 10.08.2016 – XI R 41/14, BFHE 255, 300, BStBl II 2017, 590, Rz 38[↩]
- vgl. z.B. BFH, Urteile in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 33; in BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 34; jeweils m.w.N.; vom 29.01.2014 – XI R 4/12, BFHE 244, 131, BFH/NV 2014, 992, Rz 43; vom 14.05.2014 – XI R 13/11, BFHE 245, 424, BStBl II 2014, 734, Rz 26, 27; vom 19.08.2015 – X R 30/12, BFH/NV 2016, 203, Rz 38[↩]
- BFH, Urteil in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 30[↩]
- BFH, Urteile vom 19.06.2013 – II R 26/11, BFHE 241, 431, BStBl II 2013, 1060, Rz 12; vom 11.12 2013 – II R 53/11, BFHE 244, 56, BStBl II 2014, 352, Rz 16; jeweils m.w.N.; vom 07.12 2016 – II R 1/15, BFHE 256, 534, BStBl II 2017, 360, Rz 12; BFH, Beschluss vom 30.03.2015 – II B 79/14, BFH/NV 2015, 1013, Rz 4[↩]
- vgl. EuGH, Urteile Taksatorringen vom 20.11.2003 – C-8/01, EU:C:2003:621, UR 2004, 82, Rz 39; Kommission/Griechenland vom 07.12 2006 – C-13/06, EU:C:2006:765, HFR 2007, 178, Rz 10; BGZ Leasing, EU:C:2013:15, HFR 2013, 270, Rz 58; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 28, 42; BFH, Urteil in BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 53[↩]
- EuGH, Urteile Skandia vom 08.03.2001 – C-240/99, EU:C:2001:140, UR 2001, 157, Rz 41; Taksatorringen, EU:C:2003:621, UR 2004, 82, Rz 41; Swiss Re Germany Holding vom 22.10.2009 – C-242/08, EU:C:2009:647, BStBl II 2011, 559, Rz 36; BGZ Leasing, EU:C:2013:15, HFR 2013, 270, Rz 58; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 29; BFH, Urteil in BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 54[↩]
- EuGH, Urteile CPP, EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 18; Kommission/Griechenland, EU:C:2006:765, HFR 2007, 178, Rz 11; Leipold in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 4 Nr. 10 Rz 10; Burgmaier in Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, § 4 Nr. 10 Rz 24; Klenk in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 4 Nr. 10 Rz 38, 47 ff.[↩]
- EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 39[↩]
- BFH, Urteil in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 53[↩]
- EuGH, Urteil CPP, EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 33; BFH, Urteil vom 29.11.2006 – II R 78/04, BFH/NV 2007, 513, unter II. 1., Rz 10; Klenk in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 4 Nr. 10 Rz 29[↩]
- EuGH, Urteil CPP, EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 23; BFH, Urteile in BFH/NV 2003, 669, unter II. 2., Rz 24; vom 13.07.2006 – V R 24/02, BFHE 213, 430, BStBl II 2006, 935, unter II. 2.c bb, Rz 35[↩]
- BFH, Urteil in BFHE 200, 126, BStBl II 2003, 378, unter II. 2., Rz 37[↩]