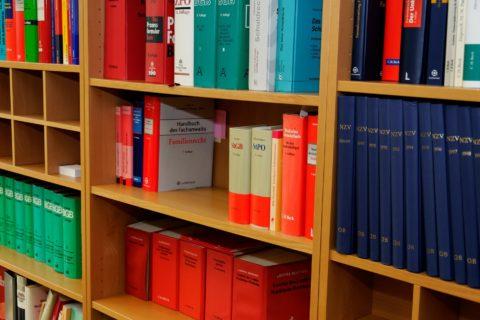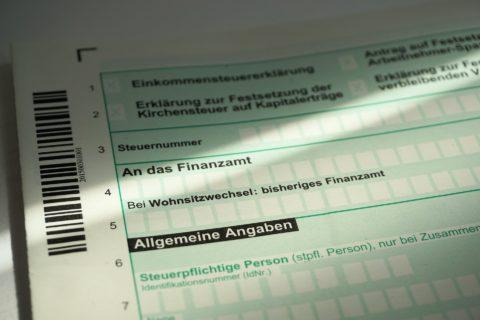Die Einkommensteuerermäßigung für Handwerkerleistungen kann auch von Ehegatten nur für eine Wohnung in Anspruch genommen werden. Der Bundesfinanzhof entschied, dass zusammen veranlagte Ehegatten, die mehrere Wohnungen nutzen, die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nur einmal bis zum gesetzlich geregelten Höchstbetrag (im Streitfall 600 €; aktuell 1.200 €) in Anspruch nehmen können.

Auch im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten nach § 26b EStG ist die Steuerermäßigung des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG bei mehreren von den Ehepartnern tatsächlich genutzten Wohnungen auf den Höchstbetrag von 600 EUR begrenzt .
In dem jetzt vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall bewohnten die Kläger Einfamilienhäuser an zwei Orten und ließen durch verschiedene Handwerksbetriebe Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den beiden Wohnungen durchführen. In der gemeinsamen Einkommensteuererklärung für das Streitjahr beantragten die Ehegatten für beide Wohnungen jeweils eine Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsleistungen nach § 35a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Das Finanzamt gewährte die Steuerermäßigung abweichend von der Einkommensteuererklärung lediglich bis zum Höchstbetrag von 600 €.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung: Für eine mehrfache Inanspruchnahme der Steuerermäßigung findet sich kein Anhaltspunkt im Gesetz, entschieden die Münchener Richter. Aus dem Wortlaut der Vorschrift ergebe sich lediglich, dass die Handwerkerleistungen in einem inländischen Haushalt zu erbringen sind. Daraus könne nicht geschlossen werden, dass bei mehreren tatsächlich genutzten Wohnungen die Steuerermäßigung auch mehrfach zu gewähren sei. Auch die Begrenzung der Steuerermäßigung der Höhe nach gelte unabhängig davon, ob die steuerbegünstigten Leistungen in einer oder in mehreren Wohnungen erbracht worden seien.
Zusammen veranlagten Ehegatten wird danach die Steuerermäßigung nur einmal gewährt. Eine Benachteiligung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch die Begrenzung der Steuerermäßigung auf 600 € auch bei mehreren tatsächlich genutzten Wohnungen sieht der Bundesfinanzhof nicht. Denn auch Alleinstehende, die gemeinsam in zwei Wohnungen wirtschaften, können die Höchstbeträge des § 35a EStG ebenfalls nur einmal in Anspruch nehmen (§ 35a Abs. 3 EStG). Damit ist allein die gemeinsame Wirtschaftsführung am Ort oder den Orten der Leistungserbringung, nicht aber der Familienstand entscheidend.
Nach § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die in einem inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden, mit Ausnahme der nach dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW Förderbank geförderten Maßnahmen, auf Antrag um 20 %, höchstens 600 €, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen.
§ 35a Abs. 2 Satz 2 EStG gilt nach seinem Wortlaut nur für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, “die in einem inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden”. Der Begriff “Haushalt”, der auch in § 35a Abs. 1 Satz 1 EStG sowie § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG Verwendung findet, ist gesetzlich nicht näher bestimmt. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist hierunter die Wirtschaftsführung mehrerer (in einer Familie) zusammenlebender Personen oder einer einzelnen Person zu verstehen. Dabei ist die Wohnung der räumliche Bereich, in dem sich der Haushalt entfaltet.
Im Streitfall wurden die Handwerkerleistungen in der Wohnung der Kläger in H und in der Wohnung in K erbracht und damit unstreitig in einem inländischen Haushalt. Durch die Bezugnahme auf den Haushalt des Steuerpflichtigen wird aber nach Auffassung des erkennenden Senats nur der Ort bestimmt, an dem die jeweilige steuerbegünstigte Leistung zu erbringen ist. Entgegen der Auffassung des FG kann aus der Bezugnahme des Gesetzes auf einen “inländischen Haushalt” nicht geschlossen werden, dass bei mehreren tatsächlich genutzten Wohnungen die Steuerermäßigung auch mehrfach zu gewähren ist. Der Wortlaut der Vorschrift gibt dafür allein durch die Bezugnahme auf den Ort der Leistungen keinen Anhalt.
Nach § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG “ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer … auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 600 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen”. Nach dem Wortlaut der Vorschrift wird die Steuerermäßigung damit der Höhe nach begrenzt und zwar unabhängig davon, ob die steuerbegünstigten Leistungen in einer oder in mehreren Wohnungen erbracht worden sind. Für eine mehrfache Inanspruchnahme der Steuerermäßigung findet sich wiederum kein Anhalt im Gesetz.
Eine andere Betrachtung ist auch im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht geboten. Da im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten nach § 26b EStG die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt haben, zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und, soweit nichts anders vorgeschrieben ist, die Ehegatten sodann –z.B. für die Anwendung des § 35a EStG– gemeinsam als Steuerpflichtiger behandelt werden, wird zusammen veranlagten Ehegatten die Steuerermäßigung des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG nach dem insoweit klaren Wortlaut der Vorschrift nur einmal gewährt.
Weder das Ziel der Regelung des § 35a EStG noch der systematische Zusammenhang der Vorschrift führen nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zu einer anderen Auslegung.
Das Ziel der gesetzlichen Regelung, die Schwarzarbeit in den Privathaushalten zu bekämpfen, zwingt nicht dazu, die Steuerermäßigung ohne betragsmäßige Begrenzung für jede Wohnung eines Steuerpflichtigen zu gewähren. Der Gesetzgeber ist nicht gehalten, bei steuerlichen Lenkungsnormen diese ohne jede Beschränkung auszugestalten. Aus der weitgehenden Gestaltungsfreiheit des Steuergesetzgebers folgt, dass es grundsätzlich in dessen Ermessen steht, ob und ggf. in welcher Form und in welchem Umfang steuerliche Erleichterungen gewährt werden sollen.
Der systematische Zusammenhang des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG mit den Regelungen in § 26a Abs. 2 Satz 4 und § 35a Abs. 3 EStG bestätigt nach Auffassung des erkennenden Senats dieses Auslegungsergebnis. Da im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten nach § 26b EStG die Steuerermäßigung –unabhängig von der Zahl der tatsächlich genutzten Wohnungen– nur einmal gewährt wird, regelt § 26a Abs. 2 Satz 4 EStG flankierend, dass im Fall der getrennten Veranlagung von Ehegatten eine Aufteilung der Steuerermäßigung zu erfolgen hat. § 35a Abs. 3 EStG sieht das gleiche Ergebnis für Alleinstehende vor, die gemeinsam in einem Haushalt leben. Beide Regelungen wären nicht erforderlich, wenn man der Auffassung des FG folgen würde und einem Steuerpflichtigen –im Streitfall den zusammen veranlagten Ehegatten– den Höchstbetrag von 600 € für jede tatsächlich genutzte Wohnung gewähren würde.
Eine Verdoppelung bzw. Vervielfältigung der Steuerermäßigung im Wege der verfassungskonformen Auslegung des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG bei Ehegatten ist nicht geboten. Insbesondere ist keine Benachteiligung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch die Begrenzung der Steuerermäßigung auf 600 EUR auch bei mehreren tatsächlich genutzten Wohnungen zu beklagen. Denn auch Alleinstehende, die gemeinsam in zwei Wohnungen wirtschaften, können die Höchstbeträge des § 35a EStG ebenfalls nur einmal in Anspruch nehmen (§ 35a Abs. 3 EStG). Damit ist allein die gemeinsame Wirtschaftsführung am Ort oder den Orten der Leistungserbringung i.S. des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG, nicht aber der Familienstand entscheidend.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 29. Juli 10 – VI R 60/09