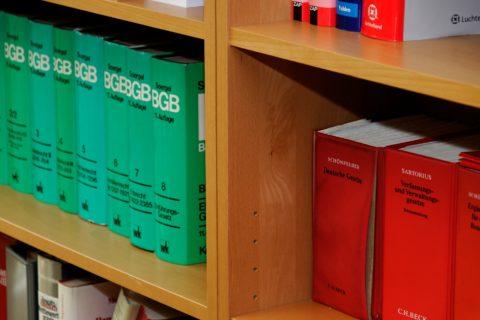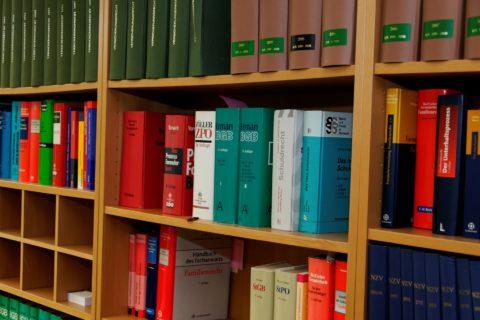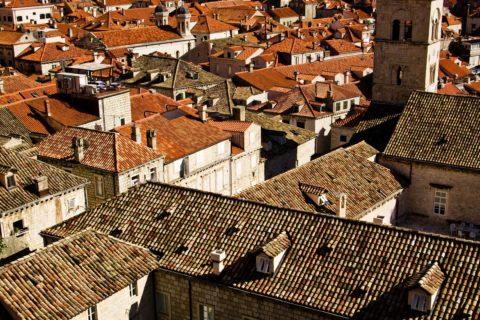Das Aufbringen von Beschichtungen in flüssiger Form (Elastomere) auf Böden in Industrie, Gewerbe- und Privatgebäuden unterfällt dem Geltungsbereich des allgemeinverbindlichen Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe vom 20.12 1999 (VTV).

Ein Betrieb wird vom Geltungsbereich des VTV erfasst, wenn in ihm arbeitszeitlich überwiegend Tätigkeiten ausgeführt werden, die unter die Abschnitte I bis V des § 1 Abs. 2 VTV fallen. Auf wirtschaftliche Gesichtspunkte wie Umsatz und Verdienst oder auf handels- und gewerberechtliche Kriterien kommt es nicht an. Betriebe, die überwiegend eine oder mehrere der in den Beispielen des § 1 Abs. 2 Abschn. V VTV genannten Tätigkeiten ausführen, fallen unter den betrieblichen Geltungsbereich des VTV, ohne dass die Erfordernisse der allgemeinen Merkmale der Abschnitte I bis III geprüft werden müssen. Nur wenn in dem Betrieb arbeitszeitlich überwiegend nicht die in den Abschnitten IV und V genannten Beispielstätigkeiten ausgeführt werden, muss darüber hinaus geprüft werden, ob die ausgeführten Tätigkeiten die allgemeinen Merkmale der Abschnitte I bis III erfüllen.
Die vom Bodenverlegungsunternehmen entfaltete Tätigkeit ist keine der nach § 1 Abs. 2 Abschn. V Nr. 38 VTV nur dann dem Tarifvertrag unterfallende Tätigkeit, wenn sie im Zusammenhang mit anderen baulichen Leistungen erfolgt.
Die Tarifvorschrift lautet:
“Zu den in den Abschnitten I bis III genannten Betrieben gehören z. B. diejenigen, in denen Arbeiten der nachstehend aufgeführten Art ausgeführt werden:
…
38. Verlegen von Bodenbelägen in Verbindung mit anderen baulichen Leistungen …”
Die von der Unternehmerin erbrachten Leistungen sind kein “Verlegen von Bodenbelägen” im Sinne der Tarifvorschrift. Das ergibt deren Auslegung.
Bereits nach dem Wortlaut der Tarifnorm, von dem in erster Linie auszugehen ist, liegt die Einordnung der von der Arbeitgeberin entfalteten Tätigkeit als “Verlegen von Bodenbelägen” fern. Auch wenn es angehen mag, eine durch Aufbringen von Flüssigkeit entstandene Beschichtung eines Bodens als “Belag” zu bezeichnen, so ist doch aus der Verwendung im Zusammenhang mit dem Tätigkeitswort “Verlegen” leicht erkennbar, dass die Tarifvertragsparteien die “klassische” Form des Verlegens von vorgefertigten, in Rollen oder in Fliesen angelieferten textilen oder nichttextilen Belägen vor Augen hatten, die erst vor Ort zugeschnitten, eingepasst und auf die Bodenoberfläche gelegt werden. Der tarifliche Wortgebrauch weist darauf hin, dass es sich um Beläge handeln muss, die nicht irgendwie, sondern in einer spezifischen Weise auf den Boden gelangen. Es reicht nicht aus, dass sie im Ergebnis – als Beläge – an der Oberfläche haften, sondern sie müssen “verlegt” werden. Flüssigkeiten werden jedoch nach allgemeinem Sprachgebrauch regelmäßig nicht auf dem Boden “verlegt”, sondern, wie im Falle der von der Arbeitgeberin ausgeführten Tätigkeiten, auf die Oberfläche gegossen, möglicherweise auch gestrichen, gespritzt oder auf andere Weise aufgebracht und verteilt. Dass eine aufgetragene Kunststoffschicht eine gleiche oder ähnliche Funktion haben kann wie ein in diesem Sinne “verlegter” Bodenbelag, ist unerheblich, da es bei den in Abschnitt V des § 1 Abs. 2 VTV aufgeführten Arbeiten auf die jeweilige Tätigkeit, nicht aber auf die spezielle Funktion des Arbeitsergebnisses ankommt. Der VTV nimmt gerade nicht jede separate “Herstellung” von Bodenbelägen von den baulichen Leistungen aus.
Selbst wenn aber auch das Aufbringen flüssiger Aufstriche auf einen Körper mitunter als “Verlegen” bezeichnet werden mag, zB im Falle der Aufbringung von Dekorböden durch Auftragen einer mit Bindemittel angerührten Körnung, so muss – bei dann allenfalls unklarer Wortlautbedeutung – die aus der Tarifgeschichte ablesbare Regelungsabsicht in den Vordergrund rücken. Die mit Nr. 38 des Beispielkatalogs in § 1 Abs. 2 Abschn. V VTV verbundene Absicht besteht darin, das Verlegen von Bodenbelägen nicht unter den Geltungsbereich der Tarifverträge des Baugewerbes fallen zu lassen, da es sich hierbei um typische Aufgaben des Raumausstattergewerbes handelt, für das ein spezifisches Berufsbild und spezielle Tarifverträge bestehen. Diesen Umständen wollten die Tarifvertragsparteien des Baugewerbes in ihrer Regelung ersichtlich Rechnung tragen. Die Tarifvertragsparteien haben einen Teilbereich aus dem Tätigkeitsfeld des Raumausstattergewerbes, nämlich die Verlegung von Bodenbelägen, nur dann im Sinne einer beschränkenden Ausnahmeregelung dem Geltungsbereich der Tarifverträge für das Baugewerbe unterwerfen wollen, wenn derartige Betriebe zugleich andere bauliche Leistungen erbringen. Entscheidend muss demnach sein, ob die von der Arbeitgeberin entfaltete Tätigkeit dem Berufsbild des Raumausstatters entspricht, weil für Tätigkeiten, die dieser Anforderung nicht entsprechen, der maßgebliche Regelungsgrund fehlt.
Das Verlegen von Bodenbelägen durch Aufbringen flüssiger Elastomere entspricht nicht dem Berufsbild des Raumausstatters.
Nach § 3 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Raumausstatter/zur Raumausstatterin vom 18.05.2004, die zuletzt am 1.08.2005 geändert worden ist, sollen dem Raumausstatter Fertigkeiten und Kenntnisse “unter Berücksichtigung der Schwerpunkte Boden, Polstern, Raumdekoration, Licht, Sicht- und Sonnenschutzanlagen sowie Wand- und Deckendekoration so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen Gesamtzusammenhang einschließt.”
Es zeigt sich, dass die von der Arbeitgeberin ausgeführten Tätigkeiten jedenfalls bisher nicht zum Lehrinhalt der Berufsausbildung des Raumausstatters/der Raumausstatterin gehören. Die auf Böden bezogenen einzelnen Tätigkeiten, in denen die Ausbildung zum Raumausstatter geschieht, sind durchweg solche, bei denen die Böden nicht durch Aufbringen von Flüssigkeiten beschichtet werden. Es geht nicht um jede Art der Herstellung von Bodenbelägen. Gelehrt wird vielmehr die Vorbereitung und Durchführung von Tätigkeiten, bei denen feste Bodenplatten oder Gewebe nach Kundengespräch und Prüfung der Raumsituation und des Untergrundes ausgesucht, zugeschnitten, zusammengefügt, festgeklebt usf. werden. Dagegen bestehen die von den gewerblichen Arbeitnehmern der Arbeitgeberin erbrachten Leistungen im flächenmäßigen maschinellen Auftragen von flüssigen Stoffen. Gerade die für den Beruf des Raumausstatters kennzeichnenden, an die individuelle Raumsituation angepassten Zuschneide- und Einpassungsarbeiten fehlen bei den von den Arbeitnehmern der Arbeitgeberin erbrachten Leistungen.
Im Betrieb der Arbeitgeberin wurden im Klagezeitraum baugewerbliche Tätigkeiten iSd. § 1 Abs. 2 Abschn. II VTV ausgeführt.
Von § 1 Abs. 2 Abschn. II VTV werden Tätigkeiten, die der Erstellung, Instandsetzung oder Instandhaltung von Bauwerken dienen, umfasst. Die Vorschrift ergreift alle Arbeiten, die irgendwie – wenn auch nur auf einem kleinen und speziellen Gebiet – der Errichtung und Vollendung von Bauwerken oder auch der Instandsetzung oder Instandhaltung von Bauwerken zu dienen bestimmt sind, sodass diese in vollem Umfang ihre bestimmungsgemäßen Zwecke erfüllen können. Dazu gehört auch die Herstellung von Fußböden durch Auftragen flüssiger Beläge, die den gewünschten Eindruck oder die erstrebte Pflegeleichtigkeit aufweisen sollen. Ohne die von der Arbeitgeberin aufgebrachte Beschichtung können die Böden und damit die Gebäude nicht die erwünschte Funktion erfüllen. Die von der Arbeitgeberin erbrachten Tätigkeiten sind baulich geprägt, da sie sich mit Werkstoffen des Baugewerbes und mit baugewerblichen Arbeitsmitteln, also nach den Arbeitsmethoden des Baugewerbes vollziehen.
§ 1 Abs. 2 Abschn. II VTV ist auch hinreichend bestimmt.
Die Vorschrift beschreibt die in den betrieblichen Geltungsbereich des VTV fallenden Betriebe wie folgt:
“Betriebe, die, soweit nicht bereits unter Abschnitt I erfasst, nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätigkeiten geprägten Zweckbestimmung und nach ihrer betrieblichen Einrichtung gewerblich bauliche Leistungen erbringen, die – mit oder ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen – der Erstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen.”
Diese Regelung entspricht den an für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge zu stellenden Bestimmtheitserfordernissen, da sie die verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen, die sich für Gesetze aus Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG ergeben, wahrt.
Nach diesen dürfen Eingriffe in die Berufsfreiheit nur auf Grundlage einer gesetzlichen Regelung erfolgen, die Umfang und Grenzen des Eingriffs deutlich erkennen lässt. Dabei muss der Gesetzgeber selbst alle wesentlichen Entscheidungen treffen, soweit sie gesetzlicher Regelung zugänglich sind. Dies bedeutet aber nicht, dass sich die erforderlichen Vorgaben ohne Weiteres aus dem Wortlaut des Gesetzes ergeben müssen; es genügt, dass sie sich mithilfe allgemeiner Auslegungsgrundsätze erschließen lassen. Das Bestimmtheitsgebot schließt die Verwendung konkretisierungsbedürftiger Begriffe nicht aus. Der Normgeber muss in der Lage bleiben, der Vielgestaltigkeit des Lebens Herr zu werden. Dabei lässt sich der Grad der für eine Norm jeweils erforderlichen Bestimmtheit nicht abstrakt festlegen, sondern hängt von den Besonderheiten des jeweiligen Tatbestands einschließlich der Umstände ab, die zur normativen Regelung geführt haben. Gegen die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe bestehen keine Bedenken, wenn sich mithilfe der üblichen Auslegungsmethoden, insbesondere durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes, durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für eine Auslegung und Anwendung der Norm gewinnen lässt. Die Rechtsprechung ist zudem gehalten, verbleibende Unklarheiten über den Anwendungsbereich einer Norm durch Präzisierung und Konkretisierung im Wege der Auslegung nach Möglichkeit auszuräumen.
Diesen Maßgaben wird § 1 Abs. 2 Abschn. II VTV entgegen der Auffassung der Arbeitgeberin gerecht. Ob eine Tätigkeit der Erstellung eines Bauwerks dient, ist bei den allermeisten baulichen Arbeiten augenfällig. Dass es in Randbereichen Überschneidungen mit anderen Tätigkeitsfeldern geben kann, ändert an der nötigen Bestimmtheit nichts. Die Tarifbestimmung ist Teil eines Branchentarifvertrags. Sie will bestimmte Sachverhalte regeln, die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften in ihrem Zuständigkeitsbereich gemeinsam als regelungsbedürftig und regelungsfähig erkannt haben. Das hat zur Folge, dass bei auftretenden Auslegungsfragen über den betrieblichen Anwendungsbereich die fachlichen Zuständigkeiten der Tarifvertragsparteien zur Klärung herangezogen werden können. Außerdem besteht seit vielen Jahrzehnten durch gefestigte Rechtsprechung – gerade auch im Streitfall – eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwendung der Tarifnorm.
Bedenken gegen die Verfassungsgemäßheit der Allgemeinverbindlicherklärung des VTV greifen nicht durch. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichts liegt in der Auferlegung von Beitragspflichten zu einer Sozialkasse für Außenseiter kraft Allgemeinverbindlicherklärung kein Verstoß gegen die negative Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG), die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) oder die Gewährleistung des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG; vgl. BVerfG 10.09.1991 – 1 BvR 561/89; 15.07.1980 – 1 BvR 24/74 und 1 BvR 439/79 – BVerfGE 55, 7; BAG 22.09.1993 – 10 AZR 371/92, BAGE 74, 226). Das gilt unabhängig davon, ob und unter welchen tarifvertraglichen Voraussetzungen die Arbeitgeberin Leistungen der Sozialkasse in Anspruch nehmen kann.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Februar 2014 – 10 AZR 428/13