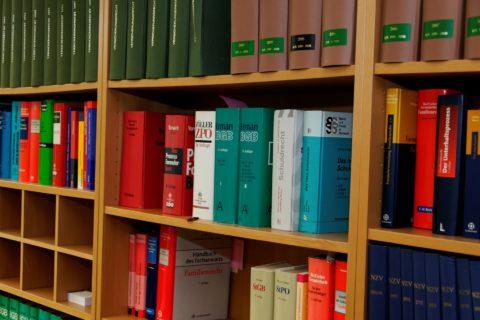Das Recht des Auftraggebers auf Selbstbeseitigung eines Mangels entsteht nach § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B, ebenso wie nach den § 634 Nr. 2, § 637 BGB, mit fruchtlosem Fristablauf. Der Geltendmachung eines auf Geld gerichteten Gewährleistungsanspruchs durch den Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer bedarf es dazu nicht. In diesen Fällen entsteht damit auch der Anspruch des Auftraggebers aus einer auf Zahlung gerichteten Gewährleistungsbürgschaft, wenn die in § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B genannten Voraussetzungen vorliegen, ohne dass ein auf Gewährleistung gestützter Zahlungsanspruch geltend gemacht werden muss.

Der Anspruch aus einer selbstschuldnerischen Bürgschaft entsteht im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB grundsätzlich mit Fälligkeit der gesicherten Hauptschuld.
Ein Anspruch ist nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB in dem Zeitpunkt entstanden, zu dem er erstmalig geltend gemacht und im Wege der Klage durchgesetzt werden kann. Dies setzt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich die Fälligkeit des Anspruchs voraus, da erst von diesem Zeitpunkt an (§ 271 Abs. 1 Halbs. 1 BGB) der Gläubiger mit Erfolg die Leistung fordern und gegebenenfalls den Ablauf der Verjährungsfrist durch Klageerhebung unterbinden kann.
Danach entstehen bei Fehlen anderer Vereinbarungen der Parteien jedenfalls die Ansprüche aus einer – hier vorliegenden – selbstschuldnerischen Bürgschaft zugleich mit der gesicherten Forderung und es bedarf für den Beginn der Verjährungsfrist keiner Leistungsaufforderung.
Dagegen ist nach Ansicht des Bundesgerichtshof die Auffassung rechtsfehlerhaft, ein Geldanspruch sei nicht entstanden, weil der Kläger zwar Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt, nicht aber deren Ablehnung angedroht habe. Die VOB/B, deren Geltung nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts im Streitfall vereinbart wurde, verlangt in § 13 Nr. 5 Abs. 2 zur Begründung eines Selbsteintrittsrechts des Auftraggebers neben der – vorliegend unstreitig erfolgten – Fristsetzung zur Nachbesserung keine Androhung des Auftraggebers, er werde die Beseitigung des Mangels nach Fristablauf ablehnen. Abweichend von der für die Wandelung und Minderung geltenden Regelung in § 634 Abs. 1 Satz 1 BGB aF entsteht nach dem klaren Wortlaut von § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B das Selbsteintrittsrecht des Auftraggebers bereits mit erfolglosem Ablauf der für die Nachbesserung gesetzten Frist. Weitere Voraussetzungen bestehen nicht. Insoweit entspricht § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B den im Rahmen eines BGBWerkvertrages für das Recht der Selbstvornahme geltenden § 633 Abs. 3 BGB aF bzw. § 634 Nr. 2 nF, § 637 BGB nF, die eine Ablehnungsandrohung des Auftraggebers ebenfalls nicht vorsehen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts scheitert damit die Entstehung der Hauptforderung auf Erstattung von Mängelbeseitigungskosten nicht daran, dass der Kläger die Ablehnung der Nachbesserung durch die Hauptschuldnerin nicht angedroht hat.
Die Einstandspflicht der Beklagten aus der Bürgschaft setzt auch nicht voraus, dass der Kläger die Hauptschuldnerin wegen der Kosten der Ersatzvornahme auf Zahlung in Anspruch nimmt. Der auf Geldzahlung gerichtete sekundäre Gewährleistungsanspruch des Auftraggebers entsteht vielmehr ohne Zahlungsaufforderung mit Ablauf der im Aufforderungsschreiben erfolglos gesetzten Frist zur Mängelbeseitigung.
Bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass der Bürge einer Gewährleistungsbürgschaft nur für das Erfüllungsinteresse und nicht für die gegenständliche Nachbesserung der Werkleistung haften soll. Der Bürgschaftsfall tritt danach ein, wenn der Auftraggeber einen auf Geld gerichteten Gewährleistungsanspruch erworben hat. Wie das Berufungsgericht von der Revision unangegriffen festgestellt hat, gilt im Streitfall nichts anderes.
Der Zeitpunkt, zu dem ein auf Geld gerichteter Anspruch des Auftraggebers auf Vorschuss für eine Ersatzvornahme der Mangelbeseitigung oder auf Erstattung der Kosten der Mangelbeseitigung fällig wird und damit den Bürgschaftsanspruch entstehen lässt, ist umstritten. Teilweise wird dafür die Erfüllung der tatbestandlichen Anspruchsvoraussetzungen (vgl. § 633 Abs. 3 BGB aF, § 637 BGB nF bzw. § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B) und die darauf beruhende Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers für ausreichend erachtet. Die Gegenansicht verlangt darüber hinaus die tatsächliche Geltendmachung eines – bezifferten – Zahlungsanspruchs, etwa als Vorschuss oder als Erstattung für die Kosten einer Ersatzvornahme, durch den Auftraggeber.
Der Bundesgerichtshof schließt sich der Auffassung an, dass der Anspruch des Auftraggebers aus einer Gewährleistungsbürgschaft entsteht, wenn die Voraussetzungen des § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B vorliegen, ohne dass zusätzlich der Auftraggeber dem Auftragnehmer gegenüber einen auf Gewährleistung gestützten Zahlungsanspruch geltend machen müsste.
Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift setzt nämlich das Selbstbeseitigungsrecht des Auftraggebers, ebenso wie bei den § 634 Nr. 2, § 637 BGB, lediglich den fruchtlosen Fristablauf voraus. Für die Auffassung, die Entstehung eines auf Geld gerichteten Gewährleistungsanspruchs verlange zudem die tatsächliche Inanspruchnahme des Unternehmers durch den Auftraggeber, findet sich weder im Wortlaut von § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B noch in § 633 BGB aF, § 634 Nr. 2 nF, § 637 BGB nF eine Stütze. Das dem Auftraggeber nach Fristablauf zustehende Wahlrecht hält somit nicht die Entstehung der zueinander in einem Auswahlverhältnis stehenden Gewährleistungsrechte in der Schwebe, sondern es setzt die Fälligkeit der zur Wahl stehenden Ansprüche voraus. Denn der Begriff der Fälligkeit beschreibt den Zeitpunkt, ab dem der Gläubiger die Leistung fordern kann, nicht den Zeitpunkt, in dem der Gläubiger die Leistung tatsächlich fordert.
Für den Bundesgerichtshof begegnet es keinen Bedenken, dass der Auftraggeber gleichzeitig fällige Ansprüche auf Nachbesserung und auf (Vorschuss-)Zahlung hat. Vielmehr ist es Kennzeichen einer Anspruchskonkurrenz, dass mehrere fällige Ansprüche nebeneinander bestehen. Sind mithin die Tatbestandsvoraussetzungen des § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B erfüllt, kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer nach Fristablauf entweder Erstattung der Kosten einer Drittnachbesserung und ggf. einen Kostenvorschuss hierfür verlangen oder auf Nachbesserung der Werkleistung bestehen. Lediglich der Auftragnehmer ist gehindert, ohne die Zustimmung des Auftraggebers die Nachbesserung durchzuführen, da dieser ab dem Ablauf der Nachbesserungsfrist allein entscheiden kann, welche Ansprüche er gegen den Auftragnehmer geltend machen will. Die Ausübung des Wahlrechts durch den Auftraggeber beantwortet – worauf die Revision zutreffend hinweist – mithin nur die Frage, welchen der bestehenden Gewährleistungsansprüche der Auftraggeber geltend machen will, sie begründet jedoch nicht einen bis dahin nicht bestehenden Anspruch.
Der von der Gewährleistungsbürgschaft gesicherte Geldanspruch – hier aus § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B – entsteht, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des auf Geld gerichteten Gewährleistungsanspruchs vom Auftraggeber geschaffen wurden. Ab diesem Zeitpunkt kann er vom Auftraggeber geltend gemacht und klageweise durchgesetzt werden. Deswegen ist es entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung für die Entstehung dieses Geldanspruchs nicht erforderlich, dass der endgültige Zahlungsanspruch oder ein Anspruch auf Vorschuss vom Auftraggeber – teilweise – beziffert werden und damit Gegenstand einer Leistungsklage sein kann. Es genügt die Möglichkeit, Feststellungsklage zu erheben. Aus diesem Grund kommt es auch nicht darauf an, ob – wie die Revisionserwiderung meint – der Kläger durch einen vorrangigen Gewährleistungseinbehalt zunächst an der Erhebung einer bezifferten Vorschussklage gehindert war.
Das Entstehen der Bürgschaftsforderung hängt nicht davon ab, dass die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer getroffene Sicherungsabrede eine Haftung des Bürgen vor Ausübung des Wahlrechts bzw. Bezifferung eines Zahlungsanspruchs vorsieht. Aus der der Bürgschaftsbestellung zugrunde liegenden Sicherungsabrede ergibt sich regelmäßig, in welchem Umfang die Bürgschaft vom Gläubiger in Anspruch genommen werden darf. Soweit der Gläubiger nach der Sicherungsabrede nicht berechtigt ist, die vereinbarte Bürgschaft anzufordern, kann sich der Bürge aus § 768 Abs. 1 Satz 1 BGB auf eine entsprechende Einrede berufen. Danach beträfe der Einwand, der Gläubiger sei nach der konkreten Sicherungsabrede nicht berechtigt, die Bürgschaft mit Entstehen der Hauptforderung, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt anzufordern, hier jedenfalls nicht die Fälligkeit der Hauptforderung und damit auch nicht den Bestand der Bürgschaftsverpflichtung. Ob der Bürge dem Auftraggeber aus der Sicherungsabrede eine solche zur Leistungsverweigerung berechtigende Einrede entgegenhalten kann, ist daher eine gegenüber der Anspruchsentstehung im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB nachgelagerte Frage.
Die von der Revisionserwiderung geforderte Anknüpfung des Beginns der Verjährungsfrist für die Gewährleistungsbürgschaft an die Geltendmachung eines bezifferten Zahlungsanspruchs durch den Auftraggeber widerspricht zudem dem Zweck der Verjährung der Bürgenverpflichtung.
Das Rechtsinstitut der Verjährung dient dem Schutz des Schuldners und der Herstellung des Rechtsfriedens nach Ablauf der Verjährungsfrist. Damit ist es unvereinbar, den Beginn der Verjährungsfrist einseitig an eine Leistungsaufforderung des Gläubigers der Bürgschaftsforderung – hier ein Zahlungsverlangen des Auftraggebers an den Auftragnehmer – zu knüpfen, da es dieser dann in der Hand hätte, den Verjährungsbeginn und die Notwendigkeit verjährungshemmender Maßnahmen weitgehend beliebig hinauszuzögern.
Die danach früher eintretende Notwendigkeit, die Verjährung hemmende Maßnahmen zu ergreifen, erhöht das Haftungsrisiko des Gewährleistungsbürgen nicht zwangsläufig. Zur Hemmung der Verjährung genügt die Erhebung einer unbezifferten Feststellungsklage. Wegen § 286 Abs. 1 und 4 BGB fällt die Gefahr, der Bürge könnte frühzeitig in Verzug geraten, nicht ins Gewicht, zumal der Gläubiger Informationen zur Hauptschuld, die der Bürge mit zumutbaren Anstrengungen nicht erlangen kann, mitzuteilen hat. Einer frühzeitigen Inanspruchnahme zur Anspruchssicherung kann der Gewährleistungsbürge schließlich dadurch entgehen, dass er – wie im Streitfall die Beklagte – für einen bestimmten Zeitraum auf die Erhebung der Verjährungseinrede verzichtet.
Der Hinweis, damit könne die nach der Schuldrechtsreform der dreijährigen Regelverjährung unterliegende Bürgschaftsforderung vor den gesicherten Gewährleistungsansprüchen verjähren, trifft zwar zu. Dies beruht jedoch auf dem getrennten Schicksal beider Forderungen und stellt weder eine spezifische Folge des Verjährungsbeginns von Bürgschaftsforderungen mit Fälligkeit der gesicherten Forderung noch eine Besonderheit des Werkvertragsrechts dar. Ebenso beruht auf gesetzgeberischer Entscheidung, dass der Auftraggeber Unterschiede in den Verjährungsfristen dazu nutzen kann, die Fälligkeit der Bürgschaftsverpflichtung durch die späte Geltendmachung von Gewährleistungsrechten zu verzögern. Zu verschiedenen Zeitpunkten ablaufende Verjährungsfristen von Hauptforderung und Bürgschaft werden in § 768 BGB hingenommen und liefern keine Rechtfertigung, die Verjährung der Bürgenhaftung dadurch zu erschweren, dass erst die Geltendmachung eines dem Auftraggeber gegen den Auftragnehmer zustehenden Geldanspruchs zur Entstehung der gesicherten Hauptforderung und damit zum Beginn der Verjährungsfrist führen soll.
Nichts Anderes ergibt sich im hier entschiedenen Fall aus dem von den Parteien geschlossenen Bürgschaftsvertrag.
Den Parteien des Bürgschaftsvertrags steht es frei, statt des Entstehens der Hauptforderung deren Geltendmachung als Fälligkeitsvoraussetzung der Bürgschaft zu vereinbaren. Eine solche Vereinbarung haben die Parteien weder ausdrücklich noch in schlüssiger Weise getroffen. Der Wortlaut der formularmäßigen Bürgschaftsurkunde vom 16.10.2001 liefert dafür keinen Anhalt.
Eine von den gesetzlichen Regelungen abweichende Vereinbarung der Parteien zur Fälligkeit der Bürgschaft ergibt sich auch nicht aus einer ergänzenden Vertragsauslegung. Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist durch die im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung erfolgte Neugestaltung der Verjährungsregelung keine verdeckte Regelungslücke entstanden, die die Parteien zwar nicht erkannt haben, die sie aber geschlossen hätten, wenn ihnen die Lücke bekannt gewesen wäre. Vielmehr sind die Folgen der neuen Verjährungsvorschriften für bestehende Rechtsverhältnisse in Übergangsvorschriften detailliert geregelt (vgl. Art. 229 § 6 EGBGB).
Ebenso rechtfertigt der fehlende Gleichlauf zwischen der Verjährungsfrist der Gewährleistungsansprüche, die die Parteien mit 60 Monaten vereinbart haben, und der dreijährigen Regelverjährung nach § 195 BGB, die für die Bürgschaftsverpflichtung gilt, keine ergänzende Vertragsauslegung. Auch in Fällen, in denen die Verjährungsfrist der gesicherten Schuld über die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren hinausreicht, hat der Bürgschaftsgläubiger ausreichend Gelegenheit, verjährungshemmende Maßnahmen zu ergreifen. Dies belastet ihn nicht unbillig, da er im Einzelfall zusätzlich durch den nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB hinausgeschobenen Fristbeginn geschützt wird.
Danach entstand die gegen die Beklagte gerichtete Bürgschaftsforderung des Klägers mit Ablauf der in dem Aufforderungsschreiben vom 29.10.2003 gegenüber dem Insolvenzverwalter der Hauptschuldnerin gesetzten Nachbesserungsfrist (§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB). Die subjektiven Voraussetzungen des Verjährungsbeginns (§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB) lagen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor, da der Kläger Kenntnis von der Beklagten als Schuldnerin der Bürgschaftsverpflichtung und ebenso von den Umständen hatte, die sowohl die Fälligkeit des auf Geld gerichteten Gewährleistungsanspruchs als auch der Bürgschaftsverpflichtung begründeten. Nach dem unstreitigen Sachverhalt waren ihm insbesondere die Mängel der Fassade bekannt. Er hatte zur Ursachenklärung noch vor dem an die Auftragnehmerin gerichteten Aufforderungsschreiben ein Sachverständigengutachten eingeholt. Damit war der Kläger – anders als die Revisionserwiderung meint – auch zur ordnungsgemäßen Geltendmachung dieses Baumangels in einem Klageverfahren in der Lage, da dies keine vorprozessuale Klärung der Mangelursachen erfordert, sondern eine objektive Beschreibung der Mangelerscheinungen ausreicht.
Nichts anderes würden gelten, wenn in der Klageforderung Ansprüche auf Schadensersatz enthalten sein sollten, da diese vor der Fristsetzung zur Nachbesserung mit Eintritt des Schadens an der Fassade im Sommer und Herbst 2003 entstanden wären.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 11. September 2012 – XI ZR 56/11