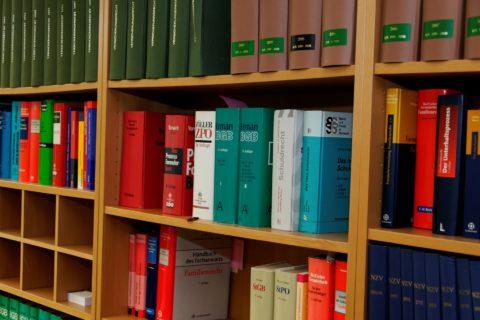Die dreijährige Verjährungsfrist des Anspruchs auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB (in der Fassung vom 23.10.2008) beginnt in entsprechender Anwendung von § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB taggenau mit dem Verlangen des Unternehmers nach Sicherheit.
In dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall verlangt eine Architektin von den Grundstückseigentümern die Stellung einer Bauhandwerkersicherung in Höhe von 4.318.313, 55 €. Die beklagten Grundstückseigentümerinnen sind die Eigentümerinnen nebeneinander gelegener Grundstücke. Sie schlossen sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen, um eine zeitgleiche, aufeinander bezogene Umnutzung beider Grundstücke nebst Umbau der Bestandsgebäude durchzuführen. Die GbR beauftragte die Architektin mit Generalplanervertrag vom 12.10.2015 mit der Erbringung von Planungsleistungen zum Umbau der bestehenden Büro- und Gewerbebebauung in zwei Wohngebäude für Studenten und Auszubildende sowie anteiliger gewerblicher Nutzung. Später vereinbarten die Vertragsparteien, dass die Planung auf die Errichtung eines Aparthotels beziehungsweise Boardinghauses angepasst werden sollte. Mit der Grundstückseigentümerinnen zu 3 am 15.10.2018 zugegangenem Schreiben vom selben Tag forderte die Architektin die GbR – im Ergebnis erfolglos auf, eine Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB (in der Fassung vom 23.10.2008) in Höhe von 1.443.590, 21 € zu stellen. Ende Oktober 2018 kündigte die GbR den Vertrag wegen vermeintlicher Pflichtverletzungen der Architektin fristlos aus wichtigem Grund. Im Rahmen eines von der Grundstückseigentümerinnen zu 3 gegen die Architektin geführten einstweiligen Verfügungsverfahrens, gerichtet auf die Herausgabe von Planungsunterlagen, fanden anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 19.12.2018 vor dem Landgericht Gespräche zwischen den Parteivertretern statt. Unter dem 14.06.2021 legte die Architektin ihre Schlussrechnung. Gleichzeitig forderte sie die GbR zur Stellung einer Bauhandwerkersicherung in Höhe von insgesamt 3.594.000 € auf. Die GbR stellte weder die geforderte Sicherheit noch leistete sie Zahlungen auf die Schlussrechnung.
Mit der vorliegenden, am 25.11.2021 bei Gericht eingegangenen Klage verlangt die Architektin von den Grundstückseigentümerinnen die Stellung einer Bauhandwerkersicherung in Höhe von insgesamt 4.318.313, 55 €. Die Grundstückseigentümerinnen haben die Einrede der Verjährung erhoben. Das Landgericht München – I hat die Klage abgewiesen[1]. Auf die Berufung der Architektin hat das Oberlandesgericht München das landgerichtliche Urteil aufgehoben und die Grundstückseigentümerinnen antragsgemäß zur Sicherheitsleistung nach ihrer Wahl in Höhe von 4.318.313, 55 € verurteilt[2]. Mit der vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revision hatten die Grundstückseigentümerinnen teilweise Erfolg, der Bundesgerichtshof hob das Berufungsurteil auf, soweit dort die Grundstückseigentümerinnen wie Gesamtschuldner zu einer den Betrag von 2.874.723, 34 € übersteigenden Sicherheitsleistung verurteilt worden sind:
Rechtsfehlerhaft hat das Oberlandesgericht München angenommen, der geltend gemachte Anspruch sei in vollem Umfang durchsetzbar und die Grundstückseigentümerinnen seien nicht berechtigt, die Sicherheitsleistung wegen Eintritts der Verjährung ganz oder auch nur teilweise zu verweigern (§ 214 Abs. 1 BGB).
Zutreffend ist allerdings der Ausgangspunkt des Oberlandesgerichts München, dass der Anspruch gemäß § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB (jetzt § 650f Abs. 1 Satz 1 BGB), wonach der Unternehmer unter den dort geregelten Voraussetzungen vom Besteller eine Sicherheitsleistung in Höhe der vereinbarten Vergütung verlangen kann, in der regelmäßigen – dreijährigen – Verjährungsfrist nach § 195 BGB verjährt[3]. Anders als die Revisionserwiderung meint, handelt es sich bei diesem Sicherungsanspruch nicht um einen Anspruch auf Begründung eines Rechts an einem Grundstück, für den nach § 196 BGB eine zehnjährige Verjährungsfrist gilt. Der Besteller kann den Sicherungsanspruch zwar durch die Bestellung einer Hypothek an einem inländischen Grundstück erfüllen (§ 232 Abs. 1 BGB). Der Unternehmer hat aber keinen Anspruch auf eine bestimmte Sicherheit. Vielmehr hat der Besteller die Wahl, die Sicherheit entweder nach Maßgabe von § 232 BGB oder in Gestalt eines Sicherungsmittels gemäß § 648a Abs. 2 BGB zu stellen[4].
Entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts München beginnt die dreijährige Verjährungsfrist des Anspruchs auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB taggenau mit dem Verlangen des Unternehmers nach Sicherheit. Das folgt aus der entsprechenden Anwendung von § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB auf diesen Anspruch. Die Vorschrift des § 199 Abs. 1 BGB, wonach die regelmäßige Verjährungsfrist, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, findet daher keine Anwendung.
Wie der e Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, handelt es sich bei dem Anspruch nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB um einen sogenannten verhaltenen Anspruch[5]. Kennzeichnend für einen derartigen Anspruch ist zum einen, dass der Schuldner die Leistung nicht bewirken darf, bevor der Gläubiger sie verlangt. Ein weiteres Merkmal eines verhaltenen Anspruchs ist zum anderen, dass seine Entstehung und das Verlangen des Gläubigers nach Leistung zeitlich auseinanderfallen (können), weswegen – abstrakt – die Gefahr einer als unbillig empfundenen Anspruchsverjährung besteht. Beides trifft auf den Anspruch aus § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB zu. Ausgehend davon hat der Bundesgerichtshof bereits ausgeführt, dass die für den Anspruch aus § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB geltende regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB) angesichts seiner Eigenschaft als verhaltener Anspruch nicht vor dem Verlangen des Unternehmers nach Sicherheit zu laufen beginnt, hierbei allerdings ausdrücklich offengelassen, ob die Verjährung mit dem Schluss des Jahres der Geltendmachung des Anspruchs oder aber taggenau mit dem Sicherungsverlangen zu laufen beginnt[6].
In Rechtsprechung und Literatur wird insoweit teilweise die Regelung des § 199 Abs. 1 BGB für anwendbar erachtet und darauf abgestellt, der Anspruch auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung sei erst im Sinne von § 199 Abs. 1 Satz 1 BGB entstanden, wenn der Unternehmer Erfüllung des Sicherungsanspruchs verlange. Ausgehend davon beginne die Verjährungsfrist mit Schluss des Jahres zu laufen, in dem die Sicherung verlangt wird[7].
Nach anderer Ansicht beginnt die Verjährung des Anspruchs auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung in entsprechender Anwendung von § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB bereits taggenau mit der Geltendmachung des Sicherungsanspruchs durch den Unternehmer[8].
Die letztgenannte Auffassung trifft zu.
Im Recht der Leihe ist geregelt, dass die Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Sache mit der Beendigung der Leihe beginnt (§ 604 Abs. 5 BGB). Da der Verleiher bei einer Leihe auf unbestimmte Zeit die Sache jederzeit zurückfordern kann (§ 604 Abs. 3 BGB), beginnt die Verjährung in diesen Fällen mit der Geltendmachung des Rückgabeanspruchs. Im Verwahrungsrecht gilt, dass die Verjährung des Anspruchs des Hinterlegers auf Rückgabe der Sache nach § 695 Satz 1 BGB mit der Rückforderung durch den Hinterleger beginnt (§ 695 Satz 2 BGB) beziehungsweise die Verjährung des Rücknahmeanspruchs des Verwahrers nach § 696 Satz 1 BGB mit dem Verlangen auf Rücknahme (§ 696 Satz 3 BGB).
Die Vorschriften der § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB, die für die dreijährige Regelverjährung (§ 195 BGB) einen taggenauen Beginn mit der Anspruchsgeltendmachung vorsehen und als Sonderregelungen der Anwendung von § 199 Abs. 1 BGB vorgehen[9], sind auf den Anspruch auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB entsprechend anzuwenden. Der Bundesgerichtshof schließt sich insoweit der Rechtsprechung weiterer Zivilsenate des Bundesgerichtshofs an, wonach die Verjährung verhaltener Ansprüche analog § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB mit der Geltendmachung des Anspruchs durch den Gläubiger beginnt[10]. Die Voraussetzungen dieser (Gesamt-)Analogie, eine Gesetzeslücke im Sinne einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes und eine vergleichbare Interessenlage[11], sind auch in Bezug auf den Anspruch auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB erfüllt.
Weder für verhaltene Ansprüche im Allgemeinen noch für den verhaltenen Anspruch nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB im Besonderen besteht eine spezielle Regelung über den Verjährungsbeginn.
Die Interessenlage hinsichtlich des speziell geregelten Verjährungsbeginns für die Ansprüche nach § 604 Abs. 3, § 695 Satz 1, § 696 Satz 1 BGB einerseits und diejenige hinsichtlich des Verjährungsbeginns bei dem Anspruch auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung andererseits sind unter den wesentlichen rechtlichen Gesichtspunkten gleich.
Nach der allgemeinen Regelung des § 199 Abs. 1 BGB kommt es für den Verjährungsbeginn auf die Entstehung des Anspruchs an. Entstanden in diesem Sinne ist ein Anspruch, wenn er vom Gläubiger im Wege der Klage geltend gemacht werden kann. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich die Fälligkeit, die dem Gläubiger im Falle eines Leistungsanspruchs die Möglichkeit einer Leistungsklage verschafft[12]. Dies bedeutet bezogen auf verhaltene Ansprüche, dass zwar die Erfüllbarkeit der Forderung von der Geltendmachung durch den Gläubiger abhängt, nicht jedoch – anders als die Revisionsbeklagte meint – die Entstehung beziehungsweise Fälligkeit des Anspruchs[13].
Auch der Gesetzgeber des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes von 2001 ging davon aus, dass die verjährungsrechtliche Entstehung eines verhaltenen Anspruchs nicht von dessen Geltendmachung abhängt. Er hat durch Einfügung der § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB den Beginn der Verjährung für die von ihm ausdrücklich als „verhalten“ identifizierten Ansprüche aus § 604 Abs. 3, § 695 Satz 1, § 696 Satz 1 BGB geregelt, nicht aber deren Entstehung. Die schon zum alten Schuldrecht ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach verhaltene Ansprüche – ebenso wie andere Ansprüche auch – zu dem Zeitpunkt entstehen, zu welchem sie frühestens geltend gemacht und notfalls im Wege der Klage durchgesetzt werden können[14], hat er in diesem Zusammenhang ausdrücklich gebilligt und sich vor deren Hintergrund für eine von § 199 Abs. 1 BGB abweichende Bestimmung des Verjährungsbeginns entschieden, um das von ihm als „absurd“ bezeichnete Ergebnis zu verhindern, dass bereits mit Vertragsschluss die dreijährige Regelverjährung nach § 195 BGB in Gang gesetzt wird mit der Folge, dass – so der Gesetzgeber – etwa eine auf unbestimmte Zeit verliehene Sache nach Ablauf von drei Jahren, bezogen auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses, nicht mehr zurückgefordert werden könnte[15]. Wäre die Geltendmachung des verhaltenen Anspruchs dagegen schon Tatbestandsmerkmal der Anspruchsentstehung im Sinne von § 199 Abs. 1 BGB, hätte es der besonderen Regelungen der § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB nicht bedurft. Dem Regelungskonzept des Gesetzes kann nicht entnommen werden, dass bei anderen verhaltenen Ansprüchen, die der Gesetzgeber nicht in Bezug genommen hat, abweichend die Geltendmachung des Anspruchs durch den Gläubiger bereits Tatbestandsmerkmal der Anspruchsentstehung sein soll.
Die abstrakte Gefahr der Anspruchsverjährung, die durch das zeitliche Auseinanderfallen von Anspruchsentstehung und Leistungsaufforderung droht und nach dem Willen des Gesetzgebers durch die besonderen Regelungen der § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2 und § 696 Satz 3 BGB verhindert werden soll, besteht allerdings nicht nur bei den vom Gesetzgeber ausdrücklich als „verhalten“ qualifizierten Ansprüchen nach § 604 Abs. 3, § 695 Satz 1, § 696 Satz 1 BGB, sondern in vergleichbarer Weise ebenso bei dem verhaltenen Anspruch gemäß § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB. Der Sicherungsanspruch entsteht bereits mit Vertragsschluss[16], sodass bei Anwendung von § 199 Abs. 1 BGB die Verjährung mit Schluss des Jahres zu laufen beginnen würde, in dem der Bauvertrag geschlossen worden ist, und damit die abstrakte Gefahr einer Verjährung des Sicherungsanspruchs vor dem endgültigen Wegfall des Sicherungsbedürfnisses des Unternehmers bestünde.
Wegen der unter den wesentlichen rechtlichen Gesichtspunkten gleich gelagerten Interessenlage ist von einer planwidrigen Gesetzeslücke auszugehen. Ein unterschiedlicher Verjährungsbeginn für die Ansprüche nach § 604 Abs. 3, § 695 Satz 1, § 696 Satz 1 BGB einerseits und für den Anspruch auf Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB andererseits entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers.
Insbesondere kann aus dem Fehlen einer eigenen Regelung über den Verjährungsbeginn verhaltener Ansprüche im Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs – anders als das Oberlandesgericht München gemeint hat – nicht der Schluss gezogen werden, dass nur für die Ansprüche aus der Leihe (§ 604 Abs. 3 BGB) und der Verwahrung (§ 695 Satz 1, § 696 Satz 1 BGB) aufgrund der besonderen Regelungen in § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2 und § 696 Satz 3 BGB die Verjährung abweichend von § 199 Abs. 1 BGB beginnen solle. Denn die Schaffung einer eigenen Regelung über den Verjährungsbeginn verhaltener Ansprüche ist nach den Motiven des Gesetzgebers des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes von 2001 lediglich wegen des Ausnahmecharakters dieser Fälle unterblieben[17]. Diese Erwägung steht der Übertragung des Regelungsgehalts von § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2 und § 696 Satz 3 BGB im Wege der (Gesamt-)Analogie auf andere verhaltene Ansprüche wie § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB von vorneherein nicht entgegen. Auch anlässlich des zum 1.01.2009 in Kraft getretenen Forderungssicherungsgesetzes, mit dem § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB eine grundlegend neue Gestalt angenommen hat, indem für den Unternehmer ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf Leistung einer Sicherheit geschaffen worden ist, hat der Gesetzgeber das Problem nicht behandelt[18], sodass nicht erkennbar ist, dass er sich damit bewusst für eine abschließende Regelung der § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB entschieden hätte.
Einem taggenauen Verjährungsbeginn des Anspruchs auf Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB mit seiner Geltendmachung aufgrund entsprechender Anwendung der § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB steht schließlich nicht entgegen, dass Ausnahmevorschriften nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs[19] grundsätzlich nicht analogiefähig sind[20]. Zwar handelt es sich bei der Kategorie der verhaltenen Ansprüche als solche um Fälle mit Ausnahmecharakter. Dies bedeutet aber nicht, dass innerhalb dieser Kategorie die Vorschriften der § 604 Abs. 5, § 695 Satz 2, § 696 Satz 3 BGB Ausnahmevorschriften wären mit der Folge, dass ihre entsprechende Anwendung auf einen weiteren solchen Ausnahmefall (hier: § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB) nicht in Betracht käme.
. Ausgehend von diesen Grundsätzen hätte das Oberlandesgericht München nicht annehmen dürfen, dass die Erhebung der unter dem 25.10.2021 anhängig gemachten Klage die Verjährung des Sicherungsanspruchs gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB insgesamt noch rechtzeitig innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist gehemmt hat, nachdem die Architektin bereits am 15.10.2018 erstmalig Sicherheit verlangt hatte.
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts München stellt sich auch nicht aus anderen Gründen insgesamt als richtig dar (§ 561 ZPO). Die Annahme des Oberlandesgerichts München, die Verjährung sei nicht in relevanter Weise nach § 203 BGB dadurch gehemmt gewesen, dass im Rahmen des auf die Herausgabe von Planungsunterlagen gerichteten einstweiligen Verfügungsverfahrens anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 19.12.2018 vor dem Landgericht auch über eine Gesamteinigung der Parteien gesprochen worden sei, begegnet für den Bundesgerichtshof keinen revisionsrechtlichen Bedenken.
Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist gemäß § 203 Satz 1 BGB die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.
Unter dem Begriff des Anspruchs in § 203 BGB ist nicht die einzelne materiellrechtliche Anspruchsgrundlage, sondern das aus dem Lebenssachverhalt hergeleitete Begehren auf Befriedigung eines Interesses zu verstehen[21]. Die von der Hemmung gemäß § 203 BGB erfassten Ansprüche werden durch den Gegenstand der Verhandlungen bestimmt, der durch Auslegung der Verhandlungserklärungen der Parteien zu ermitteln ist[22]. Diese Auslegung ist Angelegenheit des Tatrichters und revisionsgerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar. Eine Überprüfung findet nur dahin statt, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht[23].
Derartige Rechtsfehler sind dem Oberlandesgericht München nicht unterlaufen und werden von der Revisionserwiderung, die eine angestrebte Gesamteinigung der Parteien abweichend vom Oberlandesgericht München in einem weitergehenden, sich ebenfalls auf den Sicherungsanspruch erstreckenden Umfang verstanden wissen möchte, auch nicht aufgezeigt.
Das Berufungsurteil stellt sich allerdings aus anderen Gründen teilweise als richtig dar. Im Übrigen war es im tenorierten Umfang aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Bundesgerichtshof konnte insoweit in der Sache selbst entscheiden, weil die Aufhebung des Urteils nur wegen einer Rechtsverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).
Die Architektin kann von den Grundstückseigentümerinnen die Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB in Höhe von 2.874.723, 34 € verlangen. Im weitergehenden Umfang von 1.443.590, 21 € sind die Grundstückseigentümerinnen berechtigt, die Sicherheitsleistung wegen Eintritts der Verjährung zu verweigern (§ 214 Abs. 1 BGB).
Frei von Rechtsfehlern ist das Oberlandesgericht München davon ausgegangen, dass der Architektin – unbeschadet einer etwaigen Verjährung – ein Anspruch nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB auf Sicherheitsleistung für vereinbarte und noch nicht gezahlte Vergütung zuzüglich Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des zu sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, in geltend gemachter Höhe von 4.318.313, 55 € gegen die Grundstückseigentümerinnen zusteht. Die von der Revision erhobene Verfahrensrüge, die sich gegen die Sicherung des auf die Planung des Boardinghauses entfallenden Vergütungsanteils richtet, hat der Bundesgerichtshof geprüft, aber für nicht durchgreifend erachtet; von einer Begründung wird insoweit abgesehen (§ 564 Satz 1 ZPO). Die Beurteilung des Oberlandesgerichts München, dass der Anspruch insoweit dem Grunde nach feststeht, ist rechtsfehlerfrei.
Die Verjährung des Sicherungsanspruchs ist nicht in vollem Umfang von 4.318.313, 55 €, sondern lediglich in Höhe von 1.443.590, 21 € eingetreten.
Die Verjährung des Anspruchs auf Bauhandwerkersicherung nach § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB beginnt nur in der jeweils geforderten Sicherheitshöhe taggenau mit Geltendmachung zu laufen, nicht jedoch einheitlich auch für die Sicherung der übrigen vereinbarten und noch nicht gezahlten Vergütung.
Vereinbaren die Parteien im Anschluss an ein erstes Sicherungsverlangen eine Nachtragsvergütung, ist es bereits denkgesetzlich ausgeschlossen, dass die Verjährung des Sicherungsanspruchs in Höhe der Nachtragsvergütung schon mit einem früheren Sicherungsverlangen zu laufen begonnen hat. Das erste Sicherungsverlangen kann sich nicht auf einen zu diesem Zeitpunkt noch nicht existenten Werklohnanspruch beziehen. Die auch in der Sache unangemessene Konsequenz wäre zudem, dass Zusatzvergütungen, die erst drei Jahre nach dem ersten Sicherungsverlangen vereinbart werden, nicht mehr sicherbar wären[24].
Aber auch im Übrigen, nämlich wenn der Unternehmer mit einem ersten Sicherungsverlangen nur die Absicherung eines Teilbetrags der zu diesem Zeitpunkt vereinbarten Vergütung – etwa in Höhe offener Abschlagsrechnungen fordert, beginnt die Verjährungsfrist nur in der Höhe zu laufen, in der die Sicherheit verlangt wird. Dies folgt aus dem Wesen des Anspruchs auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung als verhaltenem Anspruch. Nicht nur das „Ob“, sondern auch die Höhe der verlangten Sicherheit steht innerhalb der Grenzen von § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB im Belieben des Unternehmers. Fordert der Unternehmer nur einen Teilbetrag der ihm zustehenden Sicherheit, wird dies regelmäßig darauf zurückzuführen sein, dass er keinen Anlass sieht, die Sicherheit in voller Höhe zu fordern, etwa weil er dies im Hinblick auf die aktuelle Bonität des Bestellers nicht für erforderlich erachtet, er die Kosten der Sicherheit gering halten oder das auf Kooperation angelegte Verhältnis der Bauvertragsparteien durch Geltendmachung der vollen Sicherheit nicht belasten möchte. Wäre der Unternehmer allein wegen drohender Verjährung gehalten, die Sicherheit in voller Höhe geltend zu machen und gegebenenfalls einzuklagen, würde dies den Interessen der Beteiligten nicht gerecht werden. Die einen verhaltenen Anspruch kennzeichnende abstrakte Gefahr der Anspruchsverjährung infolge des Auseinanderfallens von Entstehung und Geltendmachung des Anspruchs besteht auch für Teile des Sicherungsanspruchs, die der Unternehmer in Ermangelung eines konkreten Sicherungsbedürfnisses noch nicht geltend gemacht hat[25].
Gemessen daran ist Verjährung des streitgegenständlichen Anspruchs nur in Höhe des ersten Sicherungsverlangens vom 15.10.2018 eingetreten, also in Höhe eines Betrags von 1.443.590, 21 €. Bei der gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB zur Anspruchshemmung führenden Erhebung der unter dem 25.10.2021 anhängig gemachten Klage war die dreijährige Verjährungsfrist insoweit bereits abgelaufen. Im weitergehenden Umfang von 2.874.723, 34 € ist hingegen die Verjährung rechtzeitig durch Klageerhebung gehemmt worden, da die Architektin die Sicherheit insoweit erst mit dem zweiten Sicherungsverlangen vom 14.06.2021 beziehungsweise mit der Klage selbst geltend gemacht hat.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 21. November 2024 – VII ZR 245/23
- LG München I, Urteil vom 30.12.2022 – 2 O 15750/21[↩]
- OLG München, Entscheidung vom 21.11.2023 – 9 U 301/23 Bau e, ZfBR 2024, 318[↩]
- BGH, Urteil vom 25.03.2021 – VII ZR 94/20 Rn. 15 m.w.N., BGHZ 229, 257[↩]
- OLG Köln, Urteil vom 17.06.2020 – 11 U 186/19, BauR 2020, 1952 34; Ingenstau/Korbion/Joussen, VOB Teile A und B, 22. Aufl., Anh. 1 Rn.198[↩]
- BGH, Urteil vom 25.03.2021 – VII ZR 94/20 Rn. 21 ff., BGHZ 229, 257[↩]
- BGH, Urteil vom 25.03.2021 – VII ZR 94/20 Rn.16, 27, BGHZ 229, 257[↩]
- OLG Köln, Urteil vom 17.06.2020 – 11 U 186/19, BauR 2020, 1952 62 f.; Ingenstau/Korbion/Joussen, VOB Teile A und B, 22. Aufl., Anh. 1 Rn. 251; Grüneberg/Retzlaff, BGB, 83. Aufl., § 650f Rn. 14; Messerschmidt/Voit/Cramer, Privates Baurecht, 4. Aufl., § 650f BGB Rn. 183 f.; ähnlich BeckOGK/Mundt, BGB, Stand: 1.10.2024, § 650f Rn. 127 f.[↩]
- BeckOK Bauvertragsrecht/Scharfenberg, Stand: 1.08.2024, § 650f BGB Rn. 43; Kniffka/Jurgeleit/Schmitz, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand: 22.04.2024, § 650f BGB Rn. 48; Vogel, IBR 2023, 131[↩]
- vgl. Schmidt-Räntsch in Erman, BGB, 17. Aufl., § 199 Rn. 2[↩]
- BGH, Urteil vom 12.07.2023 – VIII ZR 125/22 Rn. 26 ff., BeckRS 2023, 20548; Urteil vom 04.05.2017 – I ZR 113/16 Rn. 23, MDR 2017, 1314; Urteil vom 21.11.2014 – V ZR 32/14 Rn. 26, DNotZ 2015, 199; Urteil vom 03.11.2011 – III ZR 105/11 Rn. 29, NJW 2012, 58[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 10.01.2019 – VII ZR 6/18 Rn.20 m.w.N., NZBau 2019, 242[↩]
- st. Rspr.; BGH, Urteil vom 12.07.2023 – VIII ZR 125/22 Rn. 27, BeckRS 2023, 20548; Urteil vom 27.10.2022 – I ZR 141/21 Rn.20, NJW-RR 2023, 480[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 04.05.2017 – I ZR 113/16 Rn. 22, MDR 2017, 1314; Schulze in Schulze, BGB, 12. Aufl., § 271 Rn. 2; a.A. MünchKommBGB/Grothe, 9. Aufl., § 199 Rn. 7[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 10.02.1988 – IVa ZR 249/86, NJW-RR 1992, 902 30 zu § 281 BGB a.F.[↩]
- BT-Drs. 14/6040, S. 258, 269[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 25.03.2021 – VII ZR 94/20 Rn. 23, BGHZ 229, 257[↩]
- BT-Drs. 14/6040, S. 258[↩]
- vgl. BT-Drs. 16/511, S. 17[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 20.12.2006 – VII ZB 92/05 Rn. 31, NJW-RR 2007, 1219; Urteil vom 02.11.1988 – VIII ZR 121/88, NJW 1989, 460 9[↩]
- a.A. BeckOGK/Mundt, BGB, Stand: 1.10.2024, § 650f Rn. 128[↩]
- BT-Drs. 14/6040, S. 112; vgl. BGH, Urteil vom 05.06.2014 – VII ZR 285/12 Rn. 12, BauR 2014, 1771[↩]
- vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 25.03.2013 – 10 U 146/12 45; Grüneberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl., § 203 Rn. 3[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 27.04.2023 – VII ZR 144/22 Rn. 35 m.w.N., BauR 2023, 1383 zum revisionsgerichtlichen Prüfungsmaßstab bei der Auslegung von Willenserklärungen[↩]
- Kniffka/Jurgeleit/Schmitz, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand: 22.04.2024, § 650f BGB Rn. 48; Leinemann/Kues/Koppmann, BGBBauvertragsrecht, 2. Aufl., § 650f Rn. 93[↩]
- so auch BeckOK Bauvertragsrecht/Scharfenberg, Stand: 1.08.2024, § 650f BGB Rn. 43; Kniffka/Jurgeleit/Schmitz, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand: 22.04.2024, § 650f BGB Rn. 48; Rodemann, IBR 2021, 296; im Ergebnis ebenso BeckOGK/Mundt, BGB, Stand: 1.10.2024, § 650f Rn. 130[↩]