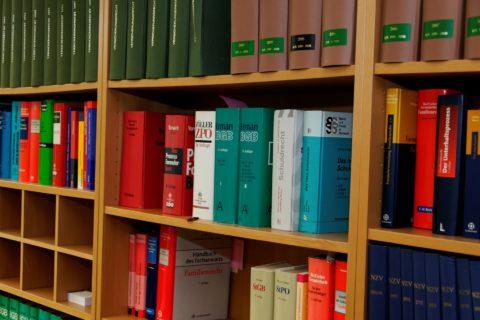Ist die die dauerhafte und ortsfeste Herstellung eines Daches die wesentliche Vertragspflicht, tritt die Lieferung der zur Herstellung erforderlichen Bauteile hinter die Verpflichtung zur Erstellung des Daches zurück. Es liegt ein Werkvertrag vor, auf den § 377 HGB keine Anwendung findet.

Mit dem Begriff “Rückgriffanspruch” wird eine Streitverkündung nicht auf Gewährleistungsansprüche beschränkt, sondern sie umfasst alle Aufwendungen des Auftraggebers, die ihm infolge der Mangelhaftigkeit der Leistung entstehen.
Vergleicht sich angesichts der Mangelhaftigkeit der Werks des Nachunternehmers der Generalunternehmer, der auf Kostenvorschuss zur Mängelbeseitigung vom Bauherrn in Anspruch genommen wird, zur Abgeltung aller Gewährleistungsansprüche abschließend auf einen unter der Schadensschätzung des Sachverständigen liegenden Betrag, liegt insoweit ein dem Nachunternehmer zuzurechnender Schaden jedenfalls dann vor, wenn auch die Voraussetzungen für die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs des Bauherrn vorlagen. Die Differenz zwischen der Schadensschätzung des Sachverständigen und des Vergleichsbetrags hat sich der Generalunternehmer im Verhältnis zum Nachunternehmer als Vorteilsausgleich anrechnen zu lassen.
Zu den aufgrund der Mangelhaftigkeit seines Werks vom Nachunternehmer zu tragenden Mangelfolgeschäden zählen die Prozesskosten des Generalunternehmers aus dem Gewährleistungsrechtsstreit mit dem Auftraggeber und die vom Generalunternehmer den anderen Beteiligten (Kläger und Streithelfer) zu erstattenden Kosten.
Nach § 651 Abs. 1 Satz 2 2. Hs BGB a.F. sind auf den Vertrag weitgehend die Vorschriften des Werkvertrags anzuwenden, wenn der Unternehmer sich verpflichtet, eine nicht vertretbare Sache herzustellen und dem Besteller die hergestellte Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen.
Verpflichtet sich ein Unternehmer, einen Gegenstand zu liefern und zu montieren, so kommt es für die rechtliche Einordnung des Vertragsverhältnisses als Kaufvertrag (mit Montageverpflichtung) oder als Werkvertrag darauf an, auf welcher der beiden Leistungen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Schwerpunkt liegt. Dabei ist vor allem auf die Art des zu liefernden Gegenstandes, das Wertverhältnis von Lieferung und Montage sowie auf die Besonderheiten des geschuldeten Ergebnisses abzustellen. Je mehr die mit dem Warenumsatz verbundene Übertragung von Eigentum und Besitz auf den “Besteller” im Vordergrund steht und je weniger die individuellen Anforderungen des Kunden und die geschuldete Montageleistung das Gesamtbild des Vertragsverhältnisses prägen, desto eher ist die Annahme eines Kaufvertrages (mit Montageverpflichtung) geboten. Besteht die Leistungspflicht in einem über die Übertragung von Eigentum und Besitz hinausgehenden Erfolg, der dem Vertrag das Gepräge gibt, handelt es sich um einen Werkvertrag. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Arbeiten an Gegenständen geschuldet sind, die nicht bewegliche Sachen sind. Wird der Einbau von Einzelteilen in ein Bauwerk übernommen und verlieren die Teile dadurch ihre Eigenschaft als selbständige Sache, spricht dies für einen Werkvertrag.
Die von der Beklagten herzustellende Dachkonstruktion war auf das zu errichtende Gebäude abgestimmt. Die für dieses Bauvorhaben hergestellten Binder stellten daher nicht vertretbare Sachen im Sinn des § 651 Abs. 1 Satz 2 BGB a. F. dar, so dass schon deshalb auf den vorliegenden Vertrag im Hinblick auf die Gewährleistung Werkvertragsrecht in Verbindung mit der VOB/B zur Anwendung kommt.
Allerdings geht der Bundesgerichtshof von einem Werkvertrag im Sinn des § 631 BGB aus, wenn nach dem Vertrag nicht die Pflicht zur Eigentumsübertragung zu montierender Einzelteile, sondern eine Herstellungspflicht im Vordergrund steht. Nach dem Inhalt des vorliegenden Vertrages stellt die Errichtung des Daches für das zu errichtende Gebäude die für die Rechtsbeziehungen der Parteien wesentliche Vertragspflicht dar. Vertraglicher Zweck war die dauerhafte und ortsfeste Herstellung dieses Daches. Das Interesse der Klägerin war nicht auf die Übereignung der vorgefertigten Bauteile, sondern auf die Erstellung eines funktionsfähigen Daches für das Gebäude gerichtet. Die Lieferung der zur Herstellung erforderlichen Bauteile tritt in einem solchen Fall hinter die Verpflichtung zur Erstellung des Daches als dem eigentlichen Vertragsziel zurück. Auf einen solchen Werkvertrag findet § 377 HGB keine Anwendung.
In dem Rechtsstreit zwischen dem Bauherrn und der jetzigen Klägerin vor dem OLG Stuttgart hatte die jetzige Klägerin in der Berufungsbegründung der jetzigen Beklagten den Streit verkündet. Ihr Beitritt auf Seiten der jetzigen Klägerin erfolgte mit Anwaltsschriftsatz vom 17.09.2008. Die Streitverkündung hat die jetzige Klägerin damit begründet, bei mangelhafter Leistung der jetzigen Beklagten einen Rückgriffanspruch gegen diese zu haben. Damit genügte die Streitverkündungsschrift den Konkretisierungserfordernissen. Mit dem Begriff “Rückgriffanspruch” wurde die Streitverkündung nicht auf Gewährleistungsansprüche beschränkt, sondern umfasste alle Aufwendungen der jetzigen Klägerin, die ihr infolge der Feststellung der Mangelhaftigkeit der Leistung der jetzigen Beklagten entstehen sollten. Gegen die Wirksamkeit der Streitverkündung bestehen keine darüber hinausgehenden Bedenken. Gemäß §§ 74 Abs. 1, Abs. 3, 68 ZPO wird danach die Beklagte im Verhältnis zur Klägerin mit der Behauptung nicht gehört, dass der vorangegangene Rechtsstreit unrichtig entschieden worden sei.
Die Interventionswirkung nach §§ 74 Abs. 3, 68 ZPO kommt nicht nur dem Entscheidungsausspruch, sondern auch den tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen zu, auf denen das Urteil im Vorprozess beruht. Das gilt aber nicht für Feststellungen des Erstgerichts, auf denen sein Urteil nicht beruht (so genannte überschießende Feststellungen). Tragend sind danach nur die erheblichen Feststellungen des Ersturteils, die nicht hinweg gedacht werden können, ohne dass das konkrete Entscheidungsergebnis entfiele. Welche Feststellungen tragend und welche überschießend sind, beurteilt sich nicht nach der Sicht des Erstgerichts, sondern danach, worauf die Entscheidung des Erstprozesses objektiv nach zutreffender Rechtsauffassung beruht. Gibt es für eine Entscheidung verschiedene Begründungsmöglichkeiten, nehmen die Feststellungen an der Interventionswirkung teil, die vom Erstgericht auf dessen Lösungsweg notwendigerweise getroffen wurden, und zwar auch dann, wenn sie sich bei einem anderen Ansatz erübrigt hätten.
Vorliegend wurde die Leistung der Beklagten zwar nicht ausdrücklich, aber durch die unstreitige Bezahlung der Schlussrechnung der Beklagten konkludent abgenommen. Die Ansprüche der Klägerin ergeben sich daher aus § 13 Nr. 7 Abs. 3 S. 1 VOB/B.
Die Werkleistung der Beklagten weist einen erheblichen Mangel der Statik auf, der die Gebrauchsfähigkeit des Werks beeinträchtigt und auf einem Verschulden der Beklagten beruht.
Gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B (2000) ist ein Werk nur dann mangelfrei, wenn es zur Zeit der Abnahme die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Nicht nachvollziehbar ist die Auffassung des Landgerichts, das Gewerk des Zimmermanns sei nicht mangelhaft, sondern nur das Gewerk der Klägerin, weil das Zusammenspiel zwischen dem Gewerk des Zimmermanns und den baulichen Vorarbeiten betroffen sei. Die von der Beklagten geschuldete Werkleistung bestand nicht nur in der Konstruktion des Daches, sondern in dessen Einbau in dem näher bezeichneten Bauvorhaben. Die Beklagte hatte die Verantwortung dafür übernommen, dass die von ihr geplante und hergestellte Dachkonstruktion für das zu errichtende Gebäude passte und zu einer mangelfreien Errichtung des Gebäude führte. Dies war aber nach den Feststellungen im Vorverfahren nicht der Fall.
Die Werkleistung der Beklagten sollte dem von der Klägerin vorgelegten Plan vom 15.02.2000 entsprechen, wonach die Dachkonstruktion nicht auf den Zwischenwänden aufliegen sollte. Dabei handelt es sich um eine vertraglich zugesicherte Eigenschaft. Aufgrund der Interventionswirkung des Urteils des Vorprozesses steht für das vorliegende Verfahren fest, dass die Dachkonstruktion an mehreren Stellen auf den Innenwänden aufliegt. Aufgrund der Interventionswirkung steht weiter fest, dass die von der Beklagten erbrachte Dachkonstruktion dadurch in ihrer Standsicherheit gefährdet ist. Die nach den einschlägigen DIN-Normen zulässigen Belastungsgrenzwerte der Binder werden um ca. 95 % überschritten, so dass bei einer Vollbelastung Bruchgefahr und damit für das Dach Einsturzgefahr besteht. Die Dachkonstruktion entspricht damit nicht den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und ist für den vom Vertrag der vorliegenden Parteien vorausgesetzten Gebrauch nicht geeignet.
Aufgrund der Interventionswirkung kann die Beklagte im vorliegenden Verfahren nicht mehr damit gehört werden, andere Baumaßnahmen, für die die Beklagte nicht verantwortlich sei und die eine größere Durchbiegung der Binder wegen zusätzlicher Lasten verursacht hätten, hätten den Mangel verursacht.
Hinsichtlich der Gewährleistungsrechte ist auf den Zustand bei Abnahme abzustellen (vgl. § 13 Nr. 1 VOB/B). Im Übrigen ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass in den letzten drei Jahren seit Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in dem vorangegangenen Verfahren Umstände eingetreten sind, die ein Aufliegen des Dachs auf den Wänden ausschließen. Vielmehr geht die Beklagte davon aus, dass die Binder schon im Jahr 2006 ihre Endstellung erreicht haben.
Die Klägerin ist nicht gemäß § 242 BGB wegen Rechtsmissbrauchs von der Geltendmachung ihrer Gewährleistungsrechte ausgeschlossen, selbst wenn die Binder eine Endstellung erreicht hätten, ohne auf den Zwischenwänden aufzuliegen, und damit die zugesicherte Eigenschaft und die Statik erfüllt wären. Die Klägerin hat nämlich selbst wegen der bei Abnahme vorhandenen Mängel die nunmehr geltend gemachten Aufwendungen gehabt, so dass der Mangel für sie nicht folgenlos geblieben ist.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Unternehmer dann nicht für den Mangel seines Werks verantwortlich, wenn dieser auf verbindliche Vorgaben des Bestellers oder von diesem gelieferte Stoffe oder Bauteile oder Vorleistungen anderer Unternehmer zurückzuführen ist und der Unternehmer seine Prüfungs- und Hinweispflicht erfüllt hat. In den genannten Fällen von verbindlichen Vorgaben und Vorleistungen ist die Eigenverantwortung des Unternehmers für die Herstellung des Werkes eingeschränkt und deshalb die verschuldensunabhängige Mängelhaftung des Unternehmers nicht uneingeschränkt interessengerecht. Hat der Unternehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemäße Vertragserfüllung gerichteten Pflichten erfüllt, entspräche sie auch nicht der Risikozuordnung des Gesetzes, wie sie in § 645 BGB zum Ausdruck kommt. Es ist deshalb nach Treu und Glauben geboten, den Unternehmer unter der Voraussetzung aus der Mängelhaftung zu entlassen, dass er seine ebenfalls auf die ordnungsgemäße Vertragserfüllung gerichtete Pflicht erfüllt hat, den Besteller auf die Bedenken hinzuweisen, die ihm bei der gebotenen Prüfung gegen die Geeignetheit der verbindlichen Vorgaben, der gelieferten Stoffe oder Bauteile oder der Vorleistung anderer Unternehmer gekommen sind oder bei ordnungsgemäßer Prüfung hätten kommen müssen. Die Verletzung der Prüfungs- und Hinweispflicht ist kein Tatbestand, der die Mängelhaftung begründet. Die verschuldensunabhängige Mängelhaftung kann nur durch einen Sach- oder Rechtsmangel des vom Unternehmer hergestellten Werkes begründet werden. Vielmehr ist die Erfüllung der Prüfungs- und Hinweispflicht ein Tatbestand, der den Unternehmer von der Sach- oder Rechtsmängelhaftung befreit. Das ist deutlich in der Regelung des § 13 Nr. 3 in Verbindung mit § 4 Nr. 3 VOB/B zum Ausdruck gebracht. Steht die Arbeit eines Werkunternehmers in engem Zusammenhang mit der Vorarbeit eines anderen Unternehmers oder ist sie aufgrund dessen Planung auszuführen, muss er prüfen und gegebenenfalls auch geeignete Erkundigungen einziehen, ob diese Vorarbeiten, Stoffe oder Bauteile eine geeignete Grundlage für sein Werk bieten und keine Eigenschaften besitzen, die den Erfolg seiner Arbeit in Frage stellen können.
Der Rahmen der Prüfungs- und Hinweispflicht und ihre Grenzen ergeben sich aus dem Grundsatz der Zumutbarkeit, wie sie sich nach den besonderen Umständen des Einzelfalls darstellt. Was hiernach zu fordern ist, bestimmt sich in erster Linie durch das vom Unternehmer zu erwartende Fachwissen und durch alle Umstände, die für den Unternehmer bei hinreichend sorgfältiger Prüfung als bedeutsam erkennbar sind. Der Unternehmer, der sich von seiner Verantwortung für einen Mangel befreien will, hat darzulegen und ggf. zu beweisen, dass er seiner Hinweispflicht nachgekommen ist oder sie im Einzelfall entfallen oder nicht kausal geworden ist.
Die Beklagte hat demgegenüber die Auffassung vertreten, für sie habe es keine “Hinweispflicht” gegeben, sondern sie habe nur den Weisungen der Klägerin nachzugehen gehabt. Auch auf den ausdrücklichen erstinstanzlichen Vortrag der Klägerin, die Beklagte habe eine Pflicht zu einem Bedenkenhinweis wegen der zu hohen Zwischenwände gehabt und sei dieser Pflicht nicht nachgekommen, hat die Beklagte die Äußerung von Bedenken gegenüber der Klägerin nicht behauptet.
Entgegen der Auffassung der Beklagten bestand hier eine Hinweispflicht. Bei der Reichweite ihrer Hinweispflicht ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt des Einbringens des Decke nach dem Vortrag der Beklagten die zu große Höhe der Zwischenwände mehr als deutlich erkennbar gewesen war. Der Sachverständige D hat in seiner erstinstanzlichen Anhörung vom 05.11.2010 erklärt, dass die Zwischenwände zum Zeitpunkt der Lieferung der Binder und des Einbaus der Dachkonstruktion schon fertig betoniert gewesen seien; es habe sich dabei um Fertigteile gehandelt. In der Anhörung durch den Senat hat die Beklagte erklärt, dass die Zwischenwände aus Beton nicht nachträglich erhöht worden seien, sondern nur Abdeckbleche angebracht und die Alu-Trapez-Zwischendecke eingebaut worden seien. Wenn also die Zwischenwände zu hoch gebaut gewesen wären, hätte dies die Beklagte bei Errichtung des Daches bemerken und Bedenken anmelden müssen. Soweit eine Überhöhung der Zwischenwände allein auf bewegliche “Abdeckbleche” oder dem Alu-Trapez-Zwischendach beruhen würde, die nachträglich eingebaut worden sind, ist dies unerheblich. Zum einen hat das OLG Stuttgart im Vorverfahren ein Aufliegen auf den Wänden und nicht den Blechkonstruktionen festgestellt. Zum andere wäre ein “Aufliegen” auf Blechen für die Statik des Daches unschädlich, weil diese im Gegensatz zu den Betonwänden gegenüber dem Gewicht des Daches nachgeben und damit die Statik des Daches nicht beeinträchtigen können.
Für den Mangel des Daches trägt die Beklagte nicht nur als Werkunternehmerin die Verantwortung, weil sie keine Bedenken wegen zu hoher Zwischenwände, auf denen nach den bindenden Feststellungen des Vorverfahrens die Binder des Daches aufliegen, geäußert hat, sondern auch als Planerin, weil sie nur von einer Durchbiegung von 6,1 cm ausgegangen ist, obwohl nach der bindenden Feststellung im Vorverfahren von einer rechnerischen Durchbiegung von über 10 cm auszugehen war.
Nachdem die Beklagte auf die Mängelrüge vom 11.11.2000 mit Fristsetzung zur Mangelbeseitigung zum 25.11.2000 nicht reagiert hat, hat die Klägerin Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 13 Nr. 7 Abs. 3 S. 1 VOB/B. Der im Vorverfahren für dieses Verfahren bindend festgestellte Mangel des Werks der Beklagten ist wesentlich im Sinne des § 13 Nr. 7 Abs. 3 S. 1 VOB/B. Dadurch wurde die Gebrauchsfähigkeit des Schweinestalls erheblich beeinträchtigt. Es liegt sowohl ein technischer als auch ein merkantiler Minderwert vor. Nach den Feststellungen im Vorverfahren kann angesichts der Gefahren, die von der Statik des Daches des Schweinestalls ausgehen, dieser zum Beispiel bei hohen Schneelasten nicht verantwortungsvoll genutzt werden.
Die Beklagte hat schuldhaft gehandelt, indem sie bei ihrer Planung von einer Durchbiegung von 6,1 cm ausgegangen ist, während nach den bindenden Feststellungen im Vorverfahren von einer rechnerischen Durchbiegung der Binder von 10,98 cm auszugehen gewesen wäre bzw. von 10,12 cm, wenn man den später eingebauten Lüftungskanal nicht berücksichtigt, und trotz dem erkennbar zu geringen Abstand zwischen den zu hohen Zwischenwänden und den Bindern des Daches keine Bedenken angemeldet hat.
Der Mitverschuldenseinwand greift nicht, weil die Beklagte die Fachplanung selbst zu erbringen hatte und die Klägerin ihr keine Bauaufsicht schuldete. Darüber hinaus musste die Klägerin das Maß der Durchbiegung nicht kennen. Es handelte sich dabei um fachspezifisches Wissen, das nur von der für die Statik und Fachplanung verantwortlichen Beklagten zu erwarten war. Die Beklagte ist für den Mangel des Dachs allein verantwortlich. Eine Gesamtschuld besteht zwischen den Parteien entgegen der Auffassung der Beklagten nicht.
Nach § 13 Nr. 7 Abs. 3 S. 1 VOB/B (2000) sind neben Mangelbeseitigungskosten auch sogenannte nahe Mangelfolgeschäden zu ersetzen. Zu diesen nahen Mangelfolgeschäden gehören auch die Kosten eines Rechtsstreits, der wegen den Mängeln geführt werden musste. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat nicht die Klägerin einen kostenaufwendigen Rechtsstreit eingeleitet, sondern der Bauherr gegen die Klägerin. Die Klägerin musste sich gegenüber den Gewährleistungsansprüchen des Bauherrn verteidigen, nachdem die Beklagte ihre Gewährleistungspflicht nicht anerkannt, sondern bestritten hatte. Letztlich war die Beklagte gehalten, durch eine Mangelbeseitigung den vorangegangenen Rechtsstreit zwischen Bauherrn und Klägerin zu vermeiden. Die Beklagte hat daher der Klägerin alle Kosten zu ersetzen, die diese aufgrund der Kostenentscheidung in Ziffer 4 des Tenors des Urteils des Vorprozesses zu tragen hat. Dazu gehören auch die Kosten des Streithelfers aus dem Vorverfahren.
Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 24. Juli 2013 – 10 U 47/12