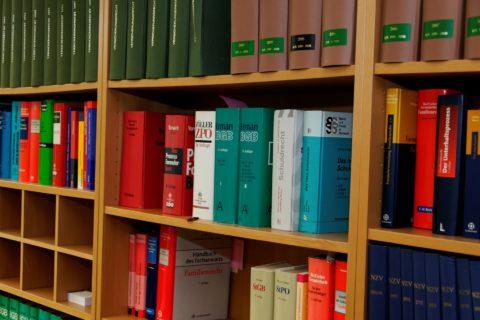Ein Bauträger (Hauptunternehmer) kann gegenüber seinem Nachunternehmer keinen Schadensersatzanspruch wegen mangelhafter Leistung geltend machen, wenn feststeht, dass der Bauträger (Hauptunternehmer) vom Käufer (Bauherrn) seinerseits nicht mehr wegen dieser mangelhaften Leistung in Anspruch genommen werden kann. Ist die Mangelbeseitigung noch möglich, so steht dem Bauträger (Hauptunternehmer) jedoch ein Leistungsverweigerungsrecht gegenüber seinem Nachunternehmer zu.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bei Mängeln in einer werkvertraglichen Leistungskette dem Auftraggeber kein auf Ersatz der Mängelbeseitigungskosten gerichteter Schadensersatzanspruch gegen seinen Auftragnehmer zusteht, wenn feststeht, dass er (der Auftraggeber) seinerseits von seinem Besteller wegen dieses Mangels nicht in Anspruch genommen wird oder genommen werden kann. Wenn nämlich feststeht, dass dem Auftraggeber keine wirtschaftlichen Nachteile durch den Mangel entstehen, ist es mit der normativen von Treu und Glauben geprägten schadensrechtlichen Wertung nicht vereinbar, dem Auftraggeber zu seiner beliebigen Verfügung den Betrag zur Verfügung zu stellen, der für die Mängelbeseitigung aufgewandt werden müsste. Anderenfalls würden dem Auftraggeber ungerechtfertigte, ihn bereichernde Vorteile zu Gute kommen.
Dieses Ergebnis widerspricht auch nicht dem ansonsten geltenden Grundsatz, dass ein Auftraggeber den ihm im Wege des Schadensersatzes zufließenden Betrag nicht zur Schadenbehebung verwenden muss, denn in diesem Fall verbleibt in seinem Vermögen unmittelbar der wirtschaftliche Schaden der mangelhaften Leistung.
Damit entfällt ein diesbezüglicher Schadensersatzanspruch (ebenso wie ein an dessen Stelle tretender etwaiger Freistellungsanspruch, vergl. hierzu Werner/Pastor, Der Bauprozess, 14. Aufl. Rn. 2220) gegenüber dem Subunternehmer.
Dies führt auch nicht zu einem mit Treu und Glauben nicht zu vereinbarenden Ergebnis. Der Auftraggeber ist in diesem Fall keinesfalls rechtlos gestellt und trägt auch nicht z.B. das Insolvenzrisiko des Auftragnehmers.
Die Auftraggeberin wäre nämlich grundsätzlich nicht gehindert, dem Verlangen der Auftragnehmerin auf Zahlung restlichen Werklohns wegen mangelhafter Leistung das gesetzliche Leistungsverweigerungsrecht entgegen zu halten. Ob die Auftraggeberin im vorliegenden Fall trotz des Umstandes, dass sie Schadensersatz geltend macht und mit einem diesbezüglichen Anspruch gegenüber der grundsätzlich berechtigten Restwerklohnforderung die Aufrechnung erklärt, zu einem Erfüllungsanspruch “zurückkehren” könnte, kann offen bleiben. Grundsätzlich schließen sich die Ansprüche auf Schadensersatz und Nacherfüllung aus und können deshalb nicht beide gleichzeitig und gleichrangig geltend gemacht werden. Der Auftraggeber ist dadurch aber nicht gehindert, vorrangig Schadensersatz zu beanspruchen und für den Fall, dass er damit keinen Erfolg hat (d.h. hilfsweise), seinen Nachbesserungsanspruch geltend zu machen. Er kann sich vielmehr vorbehalten, auf den Nachbesserungsanspruch zurückzugreifen, falls ihm der Schadensersatzanspruch nicht zuerkannt wird.
rotz ausdrücklichen Hinweises des Senates, dass der beklagte Auftraggeberin der von ihr zur Aufrechnung gestellte Schadensersatzanspruch nicht zustehen dürfte, hat sie jedoch an ihrer Rechtsauffassung festgehalten und – auch nicht hilfsweise – Nachbesserung nicht verlangt. Der Senat sieht keine Grundlage für die Auslegung des Verhaltens der Beklagten dahin, sie wolle trotz ihrer eindeutigen Erklärung Schadensersatz geltend zu machen, sich hilfsweise gegenüber der Klageforderung auf ein Leistungsverweigerungsrecht berufen.
Zwar wird im Allgemeinen davon auszugehen sein, dass eine Partei von allen Rechten Gebrauch machen will, die den gegnerischen Anspruch zu Fall zu bringen geeignet sind. Eine Zug-um-Zug-Verurteilung (Zahlung gegen Mängelbeseitigung) entspricht im vorliegenden Fall indes ersichtlich nicht der Interessenlage der Beklagten. Das zeigt sich gleichermaßen an ihrem vorprozessualen Verhalten und ihrem Agieren in diesem Rechtsstreit. So hat die Beklagte vorgerichtlich zu keinem Zeitpunkt die streitbefangenen Mängel gerügt und die Klägerin zur Beseitigung aufgefordert. Sie hat zwar in der Klageerwiderung die Einrede des nicht erfüllten Vertrages erhoben und zunächst lediglich hilfsweise Schadensersatzansprüche zur Aufrechnung gestellt. Sie hat sodann aber den Nachbesserungsanspruch nicht mehr weiter verfolgt, sondern ist zu einer unbedingten Aufrechnung mit den ihr ihrer Auffassung nach zustehenden Schadensersatzansprüchen übergegangen. Sie stellt vielmehr auch in zweiter Instanz nur noch auf die Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen ab und erstrebt nicht – auch nicht hilfsweise – die Beseitigung der behaupteten Mängel. Daran hat sie auch nach Erörterung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat festgehalten, in der gerade die Frage eine Rolle spielte, ob der Beklagten möglicherweise `nur` ein Anspruch auf Freistellung von Mängelbeseitigungsansprüchen zusteht und wie ein derartiger Anspruch gegebenenfalls gegenüber der Klageforderung prozessual geltend zu machen ist.
Die Beklagte möchte lediglich den nach ihrem Vorbringen zur Mängelbeseitigung erforderlichen Betrag zur freien Verfügung erlangen. Wie oben dargelegt ist ihr ein wie auch immer gearteter wirtschaftlicher Schaden nicht entstanden. Wie ihr gesamtes Verhalten offenbart, besteht ihrerseits auch keinerlei Interesse, den Erwerbern der beiden betroffenen Häuser nunmehr eine Leistung ´aufzudrängen`, die sie selbst nach ihrem Vorbringen innerhalb dieses Vertragsverhältnisses zu den Eheleuten A. und G. nicht schuldet, zumal die Beseitigung der behaupteten Mängel an der Isolierung der wasserführenden Leitungen mit einem erheblichen Eingriff in die Wohn- und Lebenssituation der Enderwerber verbunden wäre, ohne dass der Beklagten oder den Käufern der beiden Häuser hieraus ein messbarer Vorteil erwachsen würde.
Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 4. Dezember 2013 – 14 U 74/13