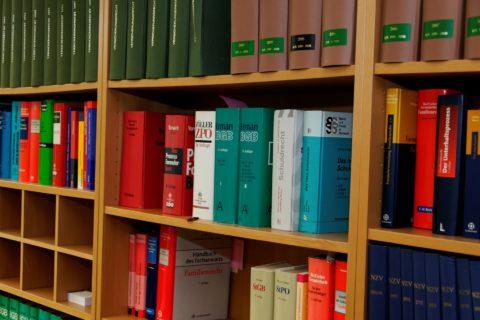Bei der Ermittlung der üblichen Vergütung i.S.v. § 632 Abs. 2 BGB ist regelmäßig nicht auf die betriebswirtschaftliche Angemessenheit abzustellen und hierüber auch kein Beweis zu erheben. Dies gilt auch, wenn die Vergleichsgruppe im Rahmen der Ermittlung der (Orts-)Üblichkeit der Vergütung – bedingt durch die Besonderheiten des Marktes (hier: Nassreinigung einer Ölspur) – klein und homogen ist. Wie im Mietwagen-Unfallersatzgeschäft ist der Geschädigte regelmäßig überfordert, wenn ihm über § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB die Aufgabe zugedacht wird, ein Marktversagen zu korrigieren.

Die Geschädigte kann auf der Grundlage ihres anerkannten Anspruchs Ersatz der Aufwendungen verlangen, die sie (hier: zur Reinigung der Straßen) für erforderlich halten durfte. Der Anspruch erstreckt sich der Höhe nach auf die übliche Vergütung nach § 632 Abs. 2 BGB, und zwar ebenfalls sowohl im Fall eines Vorgehens aus abgetretenem Recht der Stadt Karlsruhe als auch bei Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA).
Im Rahmen der üblichen Vergütung nach § 632 Abs. 2 BGB ist nicht auf die betriebswirtschaftliche Rechtfertigung der abgerechneten Preise abzustellen. Übliche ist diejenige Vergütung, die zur Zeit des Vertragsschlusses für nach Art, Güte und Umfang gleiche Leistungen nach allgemeiner Auffassung der beteiligten Kreise am Ort der Werkleistung gewährt zu werden pflegt. Dies ist anhand einer Mindestzahl von Vergleichsfällen zu prüfen.
Dass die zahlenmäßig größte Gruppe von Firmen, die sich mit der Reinigung von Verkehrsflächen befassen, nach festen Preislisten arbeitet, steht der Annahme der Ortsüblichkeit der ermittelten Preise nicht entgegen. Die Voraussetzung der Vergleichbarkeit ist auf diese Weise erfüllt, die Vergleichsgruppe ist sogar in besonderem Maße homogen. Beim Vergleich der Preise kann auch nicht auf Feuerwehren oder Kommunen abgestellt werden, die teilweise ebenfalls Reinigungsmaßnahmen durchführen. Ob diese Einheitlichkeit der Branche ökonomisch zu Lasten der Schädiger und ihrer Versicherer geht oder ob insoweit gar kartellrechtlich relevante Sachverhalte vorliegen, ist für die Anwendung von § 632 Abs. 2 BGB ohne Relevanz.
Der Bundesgerichtshof hat allerdings jüngst verlangt, dass eine mit technischen Fachleuten besetzte Fachbehörde, die ständig mit derartigen Schadensfällen und ihrer Abwicklung konfrontiert ist und sich mit anderen derartigen Fachbehörden bundesweit austauschen kann, im Rahmen einer subjektbezogenen Schadensbetrachtung Sorge dafür trägt, dass sich keine von den Reinigungsunternehmen diktierte unangemessene Preisgestaltung etabliert. Wie dies geschehen soll, erläutert der Bundesgerichtshof nicht. Er verweist lediglich auf seine Rechtsprechung, wonach nur die übliche (§ 632 Abs. 2 BGB), ersatzweise eine im Rahmen ergänzender Vertragsauslegung ermittelte angemessene oder jedenfalls eine der Billigkeit im Sinne des § 315 Abs. 3 BGB entsprechende Vergütung verlangt werden könne. Ein bei marktwirtschaftlicher Betrachtungsweise denkbarer Ansatzpunkt für einen Straßenbaulastträger, im konkreten Fall die jeweils wenigen vor Ort schnell einsatzbereiten Ölspur-Reinigungsunternehmen (oder gegebenenfalls das einzig verfügbare) zu niedrigeren Preisen zu bewegen, ergibt sich daraus nicht. Dass ein Straßenbaulastträger trotz mehrerer verfügbarer und zur Gefahrenbeseitigung vergleichbar geeigneter Straßenreinigungsunternehmen unter diesen ein besonders teures Unternehmen auswählt und beauftragt, hält das Landgericht Karlsruhe jedenfalls für wenig naheliegend. Ähnlich wie in den Fällen überhöhter Mietwagenpreise im Unfallersatzgeschäft ist der Geschädigte in aller Regel überfordert, wenn ihm über § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB die Aufgabe zugedacht wird, ein Marktversagen zu korrigieren.
Im Fall der Ölspurreinigung ist es immerhin möglich und wird inzwischen vielfach praktiziert, Rahmenverträge mit bestimmten Reinigungsunternehmen oder Gruppen solcher Unternehmen zu schließen, die regelmäßig mit gewissen Ersparnissen für die öffentlichen Auftraggeber einhergehen. Darüber hinausgehende Handlungspflichten geschädigter Gebietskörperschaften vermag das Landgericht Karlsruhe nicht zu erkennen.
Es verstößt in der Regel nicht gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot, wenn die zuständige Behörde bei einer zu beseitigenden Verschmutzung der Fahrbahn alsbald ein Fachunternehmen zur Schadensstelle beordert und bei der Beauftragung der von diesem auszuführenden Arbeiten auf den größtmöglichen zu erwartenden Beseitigungsaufwand und den sichersten Weg einer vollständigen Schadensbeseitigung abstellt. Es ist regelmäßig auch nicht zu beanstanden, wenn ein Unternehmen beauftragt wird, das der Behörde als zuverlässig bekannt ist und möglichst schnell an der Schadensstelle sein kann.
Dem Geschädigten könnte allenfalls ein Verstoß gegen seine Schadensminderungspflicht vorgeworfen werden, wenn er bei mehreren zum Schadensausgleich führenden Möglichkeiten nicht den geringeren Aufwand gewählt hätte. Für eine Kenntnis bzw. fahrlässige Unkenntnis der für die Polizei bzw. die Stadt Karlsruhe Handelnden von effizienteren und günstigeren Unternehmen, die in der damaligen Situation zeitnah zur Verfügung gestanden hätten, ist nichts festgestellt oder vorgetragen. Wenn, wie der Sachverständige B. in seinem Gutachten überzeugend ausgeführt hat, auch die anderen auf dem hiesigen Markt auftretenden Reinigungsfirmen einen Stundensatz in gleicher Höhe berechnen, ist dem Geschädigten eine günstigere Schadensbeseitigung nicht möglich.
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Straßenbaulastträger gehalten ist, zur Verhinderung von Unfällen auf der verunreinigten Straße eine zügige Reinigung in Auftrag zu geben. Die Beauftragung eines möglicherweise günstigeren Unternehmens scheitert in dieser Situation regelmäßig schon daran, dass ein solches Unternehmen das Reinigungsfahrzeug über eine längere Strecke zum Einsatzort bewegen oder transportieren müsste, was die Einsatzzeit des Reinigungsfahrzeugs beträchtlich erhöhen würde; zu einer Ersparnis käme es im Ergebnis voraussichtlich nicht.
Dabei ist die übliche Vergütung regelmäßig nicht auf einen festen Betrag oder Satz festgelegt, sondern bewegt sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite. Fehlen feste Sätze oder Beträge, kann es für die Annahme einer üblichen Vergütung ausreichen, dass für die Leistung innerhalb einer solchen Bandbreite liegende Sätze verlangt werden, innerhalb derer die im Einzelfall von den Parteien als angemessen angesehene Vergütung ohne weiteres auszumachen und gegebenenfalls durch den Tatrichter zu ermitteln ist.
Landgericht Karlsruhe, Urteil vom 20. Dezember 2013 – 9 S 671/09