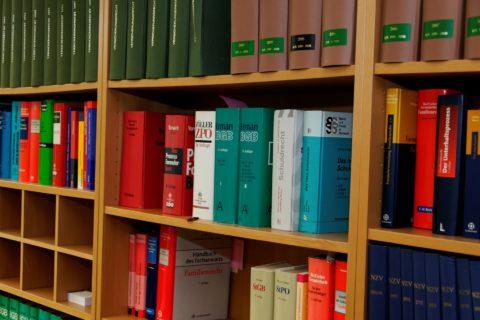Die Baugeldverwendungspflicht des § 1 Abs. 1 GSB, dem Gesetz über die Sicherung von Bauforderungen, erstreckt sich nicht auf bewilligte Darlehensbeträge, auf deren Auszahlung zwar ein fälliger und durchsetzbarer Anspruch des Darlehensnehmers besteht, die aber von ihm nicht abgerufen werden.

§ 1 GSB ist ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zugunsten der Baugläubiger.
Nach § 1 Abs. 3 GSB sind Baugeld die Beträge, die zum Zwecke der Bestreitung der Kosten eines Baus in der Weise gewährt werden, dass zur Sicherung der Ansprüche des Geldgebers eine Hypothek oder Grundschuld an dem zu bebauenden Grundstück dient. Die von einem Darlehensgeber aus Anlass eines Bauvorhabens zur Verfügung gestellten Mittel können nur dann als Baugeld angesehen werden, wenn die Vereinbarungen des Darlehensnehmers mit dem Darlehensgeber vorsehen, dass das Darlehen bewilligt wird, damit der Darlehensnehmer seine Verbindlichkeiten gegenüber Personen tilgen kann, die an der Herstellung des Baus aufgrund eines Werk, Dienst- oder Werklieferungsvertrags beteiligt sind. Die Zweckbestimmung, dass der ausgezahlte Betrag der Bestreitung der Kosten eines Baues dienen soll, muss Inhalt des Darlehensvertrags sein. Grundlage einer Baugeldgewährung können Kreditgeschäfte verschiedener Art sein, auch Kredite in laufender Rechnung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag. Ist in einem Darlehensvertrag die Verwendung der Mittel sowohl zu den in § 1 Abs. 1 Satz 1 GSB genannten Zwecken als auch zu anderen Zwecken vorgesehen, handelt es sich um ein modifiziertes Baugelddarlehen; bei derartigen Darlehensverträgen wird insoweit, als die Verwendung zu anderen als den in § 1 Abs. 1 Satz 1 GSB genannten Zwecken vorgesehen ist, kein Baugeld begründet. Ist ein Baubuch nicht geführt worden, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sämtliche kurz vor oder während der Bauzeit im Grundbuch zu Lasten des Baugrundstücks eingetragenen Hypotheken und Grundschulden Geldleistungen sichern, die zur Bestreitung der Baukosten gewährt wurden und damit Baugeld waren, solange der Empfänger dieser Beträge nicht darlegt bzw. beweist, dass sie tatsächlich ganz oder teilweise nicht zur Bestreitung der Kosten des Baues gewährt worden sind.
Gemäß § 1 Abs. 3 GSB sind Baugeld solche Geldbeträge, die zum Zweck der Bestreitung der Kosten des Baues gewährt werden. Die Gewährung setzt im Funktionszusammenhang mit dem Verwendungsgebot des § 1 Abs. 1 GSB, dessen näherer Umschreibung § 1 Abs. 3 GSB dient, voraus, dass der Darlehensnehmer die Verfügungsgewalt über die Darlehensbeträge erlangt hat. Unter diesem Begriff ist die Innehabung der Dispositionsbefugnis zu verstehen. Dieses Verständnis findet seine Bestätigung in § 1 Abs. 1 GSB, dessen Verwendungsgebot zur notwendigen Grundlage hat, dass der Empfänger von Baugeld die faktische Möglichkeit und die rechtliche Befugnis besitzt, das Baugeld zu verwenden. Die Dispositionsbefugnis erfordert, dass der Baugeldempfänger über den Baugelddarlehensbetrag ohne Weiteres verfügen kann, was z.B. dann der Fall ist, wenn dieser Betrag bar ausbezahlt oder dem Konto des Baugeldempfängers gutgeschrieben worden ist. Die Baugeldverwendungspflicht des § 1 Abs. 1 GSB kann sich auch auf Darlehensbeträge erstrecken, die der Baugelddarlehensgeber auf Anweisung des Baugeldempfängers unmittelbar an einen Dritten auszahlt.
Die Baugeldverwendungspflicht erstreckt sich indes nicht auf bewilligte Darlehensbeträge, auf deren Auszahlung zwar ein fälliger und durchsetzbarer Anspruch des Darlehensnehmers besteht, die aber von ihm nicht abgerufen werden. Gegen eine Erstreckung der Baugeldverwendungspflicht auf nicht abgerufene Darlehensbeträge spricht zunächst der Wortlaut des § 1 Abs. 1 Satz 1 GSB, der die Baugeldverwendungspflicht dem “Empfänger von Baugeld” auferlegt, auch wenn § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GSB auf Geldbeträge abstellt, “deren Auszahlung … erfolgen soll”. Darüber hinaus sprechen Sinn und Zweck von § 1 Abs. 1 GSB gegen eine derartige Erstreckung der Baugeldverwendungspflicht auf nicht abgerufene Darlehensbeträge. Damit wäre es dem Darlehensnehmer verwehrt, bis zur vollständigen Inanspruchnahme des bewilligten Baugelddarlehens andere Mittel, etwa Eigenmittel oder nicht grundpfandrechtlich gesicherte Kreditmittel, statt der nicht abgerufenen Darlehensbeträge zur Bestreitung der Kosten des Baus einzusetzen. Soweit das Oberlandesgericht Hamm annimmt, ein Empfang von Baugeld liege schon dann vor, wenn ein Kontokorrentkredit ohne triftigen Grund, der darin liegen könnte, dass andere Zuflüsse ausreichen oder wider Erwarten eigene Mittel eingesetzt werden sollen, nicht abgerufen wird, findet das in § 1 Abs. 1 GSB keine hinreichende Grundlage.
Entsprechend diesen Grundsätzen unterlag der Baugeldempfänger im vorliegenden Streitfall nicht schon mit der Einräumung der Kreditlinie dem Verwendungsgebot des § 1 Abs. 1 GSB in Bezug auf den gesamten abrufbaren, als Baugeld einzustufenden Darlehensbetrag. In den abgeschlossenen Darlehensverträgen wird ausdrücklich zwischen der Bereitstellung des Darlehens und der Auszahlung der Darlehensbeträge, die auf das Geschäftskonto des Baugeldempfängers erfolgte, unterschieden. Die Baugeldverwendungspflicht des Baugeldempfängers erstreckte sich entsprechend dem vorstehend Ausgeführten nicht auf nicht abgerufene Darlehensbeträge.
Der Baugeldempfänger haftet jedem einzelnen Baugläubiger mit dem gesamten Baugeldbetrag für dessen Bauforderung, bis das Baugeld für Bauforderungen verbraucht ist. Für den Beweis eines Verstoßes des Baugeldempfängers gegen die Verwendungspflicht des § 1 Abs. 1 GSB genügt regelmäßig der Nachweis, dass dieser Baugeld in mindestens der Höhe der Forderung des Baugläubigers erhalten hat und dass von dem Baugeld nichts mehr vorhanden ist, ohne dass eine fällige Forderung des Baugläubigers erfüllt worden wäre. Sache des in Anspruch Genommenen ist es dann, die (anderweitige) ordnungsgemäße Verwendung des Geldes, d.h. seine Auszahlung an andere Baugläubiger, darzulegen und zu beweisen. Bei einem modifizierten Baugelddarlehen, bei dem der Baugeldanteil nicht ausgewiesen ist, entspricht es dem Schutzzweck des Gesetzes über die Sicherung der Bauforderungen und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dem in Anspruch Genommenen die Darlegungs- und Beweislast dafür zuzuweisen, dass die nicht zur Bestreitung von Baukosten verwendeten Gelder einem anderen vertraglich vereinbarten Verwendungszweck zugeführt worden sind, so dass durch die Entnahme dieser Gelder eine Verringerung des der Höhe nach nicht festgelegten Baugeldes nicht eingetreten ist. Damit trägt der in Anspruch Genommene bei einem solchen modifizierten Baugelddarlehen die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Darlehensmittel insgesamt vertraglich vereinbarten Verwendungszwecken zugeführt worden sind. Verbleiben Zweifel, ob Darlehensbeträge für vertraglich vereinbarte Verwendungszwecke ausgegeben worden sind, geht dies zu dessen Lasten.
Ist der Empfänger von Baugeld eine juristische Person, so haftet auch der gesetzliche Vertreter nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 GSB, wenn er während seiner Amtszeit vorsätzlich Baugelder zweckwidrig verwendet hat und deshalb eine dem Baugläubiger zustehende Werklohnforderung nicht erfüllt wird. Ohne diesen Zugriff auf die konkret verfügungsbefugte natürliche Person wäre die Schutzfunktion der Vorschrift im typischen Fall der Insolvenz des Baugeldempfängers meist in Frage gestellt. Hat die juristische Person, die Baugeld erhalten hat, mehrere gesetzliche Vertreter, unterliegt grundsätzlich jeder von ihnen der Baugeldverwendungspflicht nach § 1 Abs. 1 GSB und haftet für eine zweckwidrige Verwendung. Entsprechendes gilt für Mitglieder eines aus mehreren Personen bestehenden vertretungsberechtigten Organs der juristischen Person, die Baugeld erhalten hat. Interne Zuständigkeitsvereinbarungen in einer mehrgliedrigen Geschäftsleitung können allerdings zu einer Beschränkung der haftungsrechtlichen Verantwortlichkeit einzelner Mitglieder führen. Bei mehreren Mitgliedern eines Organs der juristischen Person, die Baugeld empfangen hat, gilt Entsprechendes.
Bei der Verletzung des Schutzgesetzes des § 1 GSB ist bezüglich eines Verbotsirrtums das Vorliegen von Vorsatz nach der so genannten Schuldtheorie zu beurteilen. Danach entlastet ein Verbotsirrtum nur, wenn er unvermeidbar war. Bei fahrlässigem Verbotsirrtum wird demgegenüber die Sanktion als Vorsatztat nicht ausgeschlossen. Ein Verbotsirrtum ist nur dann unvermeidbar, wenn der Täter trotz der ihm nach den Umständen des Falles, seiner Persönlichkeit sowie seinem Lebens- und Berufskreis zuzumutenden Anspannung des Gewissens die Einsicht in das Unrechtmäßige seines Handelns nicht zu gewinnen vermochte. Das setzt voraus, dass er alle seine geistigen Erkenntniskräfte eingesetzt und etwa auftauchende Zweifel durch Nachdenken und erforderlichenfalls durch Einholung von Rat beseitigt hat. Hätte der Täter bei gehöriger Anspannung seines Gewissens das Unrechtmäßige seines Tuns erkennen können, so ist sein Verbotsirrtum verschuldet.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 20. Dezember 2012 – VII ZR 187/11