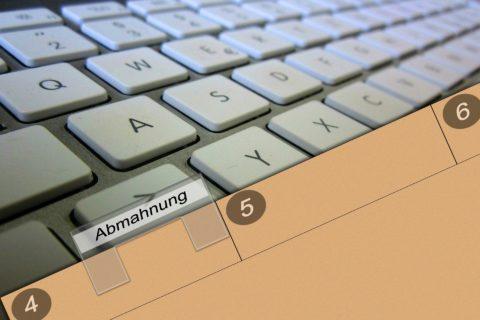Die Arbeitgeberin ist nach § 3 Nr. 1.43 Abs. 3 Alt. 2 des Bundesrahmentarifvertrags für das Baugewerbe vom 04.07.2002 idF vom 10.12.2014 (BRTV) berechtigt, wegen eines witterungsbedingt eingetretenen Arbeitsausfalls auf dem Ausgleichskonto gutgeschriebenen Lohn an den Arbeitnehmer zum Zweck des Lohnausgleichs auszuzahlen. Die in dieser Zeit bestehende krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers steht dem nicht entgegen.

Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf korrekte Führung eines eingerichteten Arbeitszeit- und Entgeltkontos, weil dieses den Vergütungsanspruch verbindlich bestimmt[1]. Der Arbeitgeber darf ohne rechtliche Befugnis nicht in das Konto korrigierend eingreifen, wenn – wie im vorliegenden Fall gemäß § 3 Nr. 1.43 Abs. 1 Satz 2 BRTV – auf dem Konto nicht lediglich Arbeitszeitguthaben und -schuld festgehalten werden, sondern auch die Differenz zwischen dem Lohn für die tatsächlich geleisteten Stunden und dem verstetigten Monatslohn gutzuschreiben bzw. zu belasten ist. Ein solches Arbeitszeitkonto hält grundsätzlich fest, in welchem zeitlichen Umfang der Arbeitnehmer seine Hauptleistungspflicht nach § 611a Abs. 1 Satz 1 BGB erbracht hat oder aufgrund eines Entgeltfortzahlungstatbestands nicht erbringen musste. Es drückt damit – in anderer Form – seinen Vergütungsanspruch aus[2]. Die materiell-rechtliche Befugnis, in das Arbeitszeitkonto eingestellte und damit grundsätzlich streitlos gestellte Arbeitsstunden wieder zu streichen, kann sich nur aus der Vereinbarung (Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag) ergeben, die der Führung des Arbeitszeitkontos zugrunde liegt[3]. Kürzt oder streicht der Arbeitgeber zu Unrecht ein im Ausgleichskonto eingestelltes Guthaben, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf (Wieder-)Gutschrift[4] oder, soweit dies wegen zwischenzeitlicher Schließung des Kontos nicht mehr in Betracht kommt, einen Anspruch auf Zahlung entsprechender Vergütung.
Nach diesen Grundsätzen war die Arbeitgeberin für die Zeit des Zusammentreffens der Erkrankung des Arbeitnehmers mit dem witterungsbedingten Arbeitsausfall vom 19.02.bis zum 2.03.2018 befugt, auf dem Ausgleichskonto des Arbeitnehmers gutgeschriebenen Lohn auszuzahlen.
Gemäß § 3 Nr. 1.43 Abs. 3 Alt. 2 BRTV darf dem Ausgleichskonto gutgeschriebener Lohn bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall ausgezahlt werden. Die Regelung steht in sachlichem Zusammenhang mit § 4 Nr. 6.1 Abs. 1 BRTV. Nach Satz 1 dieser Bestimmung entfällt der Lohnanspruch, wenn die Arbeitsleistung entweder aus zwingenden Witterungsgründen oder in der Schlechtwetterzeit aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich wird. In diesem Fall ist der Lohnausfall nach § 4 Nr. 6.1 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 BRTV durch die Auflösung von Arbeitszeitguthaben „auszugleichen“. Nur wenn ein solcher Ausgleich nicht erfolgen kann, hat der Arbeitgeber gemäß § 4 Nr. 6.1 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 BRTV das Saison-Kurzarbeitergeld „zu zahlen“.
Im hier entschiedenen Streitfall fiel in der Zeit vom 19.02.bis zum 2.03.2018 die Arbeit im Betrieb der Arbeitgeberin aus zwingenden, von der Agentur für Arbeit anerkannten Witterungsgründen (Frost und Schneefall) aus. Die Arbeitgeberin hatte deshalb gemäß § 4 Nr. 6.4 BRTV entschieden, die Arbeiten einzustellen. Auf die Unwirksamkeit dieser Entscheidung hat sich der Arbeitnehmer weder berufen noch ergeben sich aus dem Parteivorbringen hierfür Anhaltspunkte. Die Voraussetzungen für die Belastung des Ausgleichskontos nach § 3 Nr. 1.43 Abs. 3 Alt. 2 BRTV und die Durchführung eines Lohnausgleichs gemäß § 4 Nr. 6.1 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 BRTV lagen demnach in der Zeit vom 19.02.bis zum 2.03.2018 vor. Hiervon ausgehend war die Arbeitgeberin zur Auszahlung von 65 Guthabenstunden berechtigt.
Die zeitgleich bestehende Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers wegen Krankheit steht dem Ausgleich nicht entgegen[5].
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist im BRTV nicht geregelt. Er richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG besteht ein Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn der Arbeitnehmer infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert ist, dh. die Arbeitsunfähigkeit die alleinige Ursache für den Ausfall der Arbeitsleistung ist. Der Anspruch auf Arbeitsentgelt darf nicht bereits aufgrund anderer Ursachen entfallen. Der Entgeltfortzahlungsanspruch setzt demnach voraus, dass der erkrankte Arbeitnehmer ohne die Arbeitsunfähigkeit einen Vergütungsanspruch gehabt hätte[6]. Dadurch werden arbeitsunfähige und arbeitsfähige Arbeitnehmer gleichgestellt[7].
Diese Grundsätze gelten auch bei zeitlichem Zusammentreffen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit mit einer Arbeitsunterbrechung aus zwingenden Witterungsgründen.
Sind witterungsbedingte Ausfallzeiten wegen des vom Arbeitgeber nach § 615 Satz 3 BGB zu tragenden Betriebsrisikos zu vergüten, erhält auch der arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach §§ 3 und 4 EFZG. Andernfalls besteht ein solcher Anspruch nicht[8]. Im Anwendungsbereich des BRTV folgt daraus, dass der arbeitsunfähige Arbeitnehmer, soweit die Arbeit im Betrieb während seiner Arbeitsunfähigkeit entweder aus zwingenden Witterungsgründen oder in der gesetzlichen Schlechtwetterzeit aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich wird, und er bei bestehender Arbeitsfähigkeit von dem Arbeitsausfall betroffen gewesen wäre, keine Fortzahlung der Vergütung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG verlangen kann, weil ohne die Erkrankung sein Lohnanspruch nach § 4 Nr. 6.1 Satz 1 BRTV entfallen wäre.
Einem Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall steht zudem § 4 Abs. 3 Satz 1 EFZG entgegen. Danach ist im Falle einer Arbeitszeitverkürzung im Betrieb die verkürzte Arbeitszeit für ihre Dauer als die für den Arbeitnehmer maßgebende regelmäßige Arbeitszeit iSd. § 4 Abs. 1 EFZG anzusehen. Die Regelung betrifft die Kurzarbeit nach dem SGB III[9] und insoweit auch die sog. Saison-Kurzarbeit iSd. § 101 SGB III, wobei es für die Anwendung von § 4 Abs. 3 EFZG nicht darauf ankommt, ob die Kurzarbeit vor oder nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb wirksam eingeführt worden ist[10]. Nachdem die Arbeitgeberin aus zwingenden witterungsbedingten Gründen iSd. § 4 Nr. 6.2 BRTV entschieden hat, die Bauarbeiten vollständig einzustellen, ist der nach § 4 Abs. 3 Satz 1 EFZG für die Bemessung der Entgeltfortzahlung maßgebliche Zeitfaktor mit „Null“ anzusetzen. Dem Arbeitnehmer stand daher auch aus diesem Grund für die Zeit vom 19.02.bis zum 2.03.2018 ein Entgeltfortzahlungsanspruch nicht zu.
Da der Arbeitnehmer in der Zeit des witterungsbedingten Arbeitsausfalls keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall hatte, war die Arbeitgeberin zur Durchführung des Lohnausgleichs nach § 4 Nr. 6.1 Satz 2 Halbs. 1 BRTV verpflichtet. Hierdurch soll der nach Satz 1 witterungsbedingt entfallene Lohnanspruch ausgeglichen werden. Dieser Überbrückungszweck betrifft in gleicher Weise arbeitsfähige wie arbeitsunfähige Arbeitnehmer, denen ein Entgeltfortzahlungsanspruch nicht zusteht, weil sie im Fall ihrer Arbeitsfähigkeit wegen zwingender Witterungsgründe einen Entgeltzahlungsanspruch nicht gehabt hätten. Die Verwendung des Guthabens zur Durchführung eines Lohnausgleichs gegenüber arbeitsunfähigen Arbeitnehmern entspricht dem Leitgedanken des Entgeltfortzahlungsrechts, diese wirtschaftlich grundsätzlich nicht schlechter, aber auch nicht besser zu stellen als gesunde Arbeitnehmer. Die gegenteilige Auffassung der Revision, ein kranker Arbeitnehmer werde schlechter gestellt, weil es ihm nicht möglich sei, die Zeit des witterungsbedingten Arbeitsausfalls in vergleichbarer Weise wie ein gesunder zur Freizeitgestaltung zu nutzen, verkennt, dass die tariflichen Regelungen zur Durchführung des Lohnausgleichs in Zeiten witterungsbedingten Arbeitsausfalls – ebenso wie auch das gesetzliche Entgeltfortzahlungsrecht[11] – nicht die selbstbestimmte Nutzung von Freizeit sicherstellen sollen, sondern allein die Kompensation des Wegfalls des Lohnanspruchs zum Ziel haben. Auch bei den Regelungen zur Führung des Ausgleichskontos nach § 3 Nr. 1.43 BRTV geht es nicht um die Gewährleistung eines Freistellungsanspruchs des Arbeitnehmers, sondern, wie Abs. 3 der Tarifregelung belegt, wonach im laufenden Arbeitsverhältnis auf dem Konto gutgeschriebener Lohn nur zum Ausgleich für den Monatslohn und bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall ausgezahlt werden darf, um Entgeltsicherung.
Die Annahme, im Ausschluss des Entgeltfortzahlungsanspruchs bei Durchführung des Lohnausgleichs liege eine nach § 12 EFZG unzulässige Abweichung von dem gesetzlichen Grundsatz der Entgeltfortzahlung, geht fehl. Die Tarifvertragsparteien haben allein eine von der dispositiven Regelung in § 615 BGB abweichende Ausgestaltung des Entgeltanspruchs bei einem Arbeitsausfall aus zwingenden Witterungsgründen vorgenommen. Dass der arbeitsunfähige Arbeitnehmer bei zeitlichem Zusammenfallen seiner Erkrankung mit einem solchen keinen Entgeltfortzahlungsanspruch hat, ist unmittelbare Rechtsfolge der Regelungen in § 3 Abs. 1 Satz 1 bzw. § 4 Abs. 1 iVm. Abs. 3 EFZG.
Soweit geltend gemacht wird, durch § 4 Nr. 6.1 Satz 1 BRTV werde § 615 BGB lediglich auf der Rechtsfolgenseite abbedungen, weshalb jedenfalls die Auszahlung auf dem Ausgleichskonto gutgeschriebenen Lohns Annahmeverzug des Arbeitgebers voraussetze, der nach § 297 BGB bei Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers aber nicht bestehe, verkennt dies bereits grundlegend die Rechtslage. Der BRTV regelt in seinem Geltungsbereich zulässigerweise (§ 619 BGB) losgelöst von § 615 BGB die Entgeltansprüche bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall.
Soweit darauf verwiesen wird, dass sich in all diesen Fällen nach § 3 Nr. 1.43 BRTV der Monatslohn mindere, ohne dass bei Urlaub oder unbezahlter Freistellung die Inanspruchnahme des Ausgleichskontos in Betracht komme, ist die mangelnde Vergleichbarkeit von Entgeltfortzahlung und Urlaub bzw. unbezahlter Freistellung zu beachten. Die Minderung des verstetigten Monatslohns sagt nichts darüber aus, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Arbeitnehmer ein Lohnersatzanspruch zusteht und welche Konsequenzen sich – je nach den Umständen – im Hinblick auf die Inanspruchnahme des Ausgleichskontos ergeben. Dies richtet sich nach den für die jeweiligen Tatbestände bestehenden gesetzlichen, sonstigen tariflichen oder vertraglichen Regelungen.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 23. Februar 2021 – 5 AZR 304/20
- BAG 23.09.2020 – 5 AZR 367/19, Rn. 23 mwN[↩]
- BAG 23.09.2015 – 5 AZR 767/13, Rn.20, BAGE 152, 315[↩]
- BAG 23.09.2020 – 5 AZR 367/19, Rn. 21 mwN[↩]
- BAG 31.07.2014 – 6 AZR 759/12, Rn.20 mwN[↩]
- zu inhaltsgleichen tariflichen Vorgängerregelungen bereits BAG 26.09.2001 – 5 AZR 699/00, zu II der Gründe[↩]
- st. Rspr., zB BAG 27.05.2020 – 5 AZR 247/19, Rn. 49; 19.01.2000 – 5 AZR 637/98, zu II 1 der Gründe mwN, BAGE 93, 212[↩]
- BAG 28.01.2004 – 5 AZR 58/03, zu II 3 der Gründe[↩]
- vgl. – mit zT unterschiedlichen Begründungsansätzen – Feichtinger in Feichtinger/Malkmus 2. Aufl. § 3 EFZG Rn. 103; Schaub ArbR-HdB/Linck 18. Aufl. § 98 Rn. 16; ErfK/Reinhard 21. Aufl. EFZG § 3 Rn. 22; BeckOK ArbR/Ricken 58. Ed.01.12.2020 EFZG § 3 Rn. 33; Schmitt EFZG/Schmitt 8. Aufl. EFZG § 3 Rn. 118; NK-ArbR/Sievers EFZG § 3 Rn. 74; zu § 1 ArbKrankhG idF vom 12.07.1961 schon BAG 24.06.1965 – 2 AZR 354/64[↩]
- ErfK/Reinhard 21. Aufl. EFZG § 4 Rn.20; MünchKomm-BGB/Müller-Glöge 8. Aufl. EFZG § 4 Rn. 25[↩]
- vgl. Malkmus in Feichtinger/Malkmus 2. Aufl. § 4 EFZG Rn. 174; BeckOK ArbR/Ricken 58. Ed.01.12.2020 EFZG § 4 Rn. 27[↩]
- vgl. dazu BAG 15.02.2012 – 7 AZR 774/10, Rn. 37[↩]