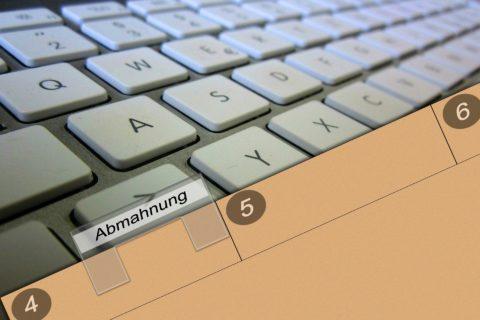Die Mindestsätze der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung aus dem Jahr 2013 sind ungeachtet der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 04.07.2019[1]– in einem laufenden Gerichtsverfahren zwischen Privatpersonen weiterhin anwendbar.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hatte in einem von der Europäischen Kommission betriebenen Vertragsverletzungsverfahren durch Urteil vom 04.07.2019[1] entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchstabe g und Abs. 3 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Dienstleistungsrichtlinie) verstoßen hat, dass sie verbindliche Honorare für die Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren beibehalten hat. In der Instanzrechtsprechung sowie im Schrifttum war daraufhin ein Meinungsstreit darüber entstanden, ob die betreffenden Vorschriften der Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens zwischen Privatpersonen in der Weise unmittelbare Wirkung entfalten, dass die der Richtlinie entgegenstehenden nationalen Regelungen in § 7 der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI), wonach die in dieser Honorarordnung statuierten Mindestsätze für Planungs- und Überwachungsleistungen grundsätzlich verbindlich sind und eine die Mindestsätze unterschreitende Honorarvereinbarung in Verträgen mit Architekten oder Ingenieuren unwirksam ist, nicht mehr anzuwenden sind.
Der Bundesgerichtshof hat daraufhin im vorliegenden Verfahren, dem die HOAI in der Fassung aus dem Jahre 2013 zugrunde liegt, dem Gerichtshof der Europäischen Union in einem Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV mehrere Fragen zur Unionsrechtswidrigkeit des verbindlichen Preisrechts der HOAI (2013) vorgelegt[2]. Der Unionsgerichtshof hat hierauf entschieden, dass das Unionsrecht dahin auszulegen ist, dass ein nationales Gericht, bei dem ein Rechtsstreit anhängig ist, in dem sich ausschließlich Privatpersonen gegenüberstehen, nicht allein aufgrund des Unionsrechts verpflichtet ist, eine nationale Regelung unangewendet zu lassen, die unter Verstoß gegen die in Rede stehenden Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie Mindesthonorare für die Leistungen von Architekten und Ingenieuren festsetzt und die Unwirksamkeit von Vereinbarungen vorsieht, die von dieser Regelung abweichen, jedoch unbeschadet zum einen der Möglichkeit dieses Gerichts, die Anwendung der Regelung im Rahmen eines solchen Rechtsstreits aufgrund des innerstaatlichen Rechts auszuschließen, und zum anderen des Rechts der durch die Unvereinbarkeit des nationalen Rechts mit dem Unionsrecht geschädigten Partei, Ersatz des ihr daraus entstandenen Schadens zu verlangen[3].
In Umsetzung dieser Vorabentscheidung des Unionsgerichtshofs hat der Bundesgerichtshof nun das vorliegende Revisionsverfahren entschieden, in dem der Betreiber eines Ingenieurbüros von der beklagten Auftraggeberin die Zahlung restlicher Vergütung aufgrund eines im Jahre 2016 abgeschlossenen Ingenieurvertrages verlangt, in dem die Parteien für die vom Ingenieurbüro zu erbringenden Ingenieurleistungen bei einem Bauvorhaben der Auftraggeberin ein Pauschalhonorar in Höhe von 55.025 € vereinbart hatten. Nachdem das Ingenieurbüro den Ingenieurvertrag gekündigt hatte, rechnete es im Juli 2017 seine erbrachten Leistungen in einer Honorarschlussrechnung auf Grundlage der Mindestsätze der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung aus dem Jahr 2013 ab. Mit der Klage hat das Ingenieurbüro eine noch offene Restforderung in Höhe von 102.934, 59 € brutto geltend gemacht.
Das erstinstanzlich hiermit befasste Landgericht Essen hat die Auftraggeberin zur Zahlung von 100.108, 34 € verurteilt[4]. Auf die Berufung der Auftraggeberin hat das Oberlandesgericht Hamm das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die Auftraggeberin zur Zahlung von 96.768, 03 € verurteilt[5]. Das Oberlandesgericht hat die Auffassung vertreten, dem Kläger stehe ein restlicher vertraglicher Zahlungsanspruch nach den Mindestsätzen der HOAI (2013) zu. Die im Ingenieurvertrag getroffene Pauschalpreisvereinbarung sei wegen Verstoßes gegen den Mindestpreischarakter der HOAI als zwingendes Preisrecht unwirksam. Das in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland ergangene Urteil des Unionsgerichtshofs ändere nichts an der Anwendbarkeit der maßgeblichen Bestimmungen der HOAI zum Mindestpreischarakter. Die hiergegen gerichtete; vom Oberlandesgericht Hamm zugelassene Revision der Auftraggeberin hat der Bundesgerichtshof nun als unbegründet zurückgewiesen:
Wie der Bundesgerichtshof bereits in seinem Vorlagebeschluss an den Unionsgerichtshof vom 14.05.2020 ausgeführt hat, sind nach nationalem Recht die Vorschriften der HOAI, die das verbindliche Preisrecht (hier: die Mindestsätze) regeln, unbeschadet des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 04.07.2019[6] anzuwenden und führen zu einem Honoraranspruch des Klägers in der vom Oberlandesgericht Hamm zuerkannten Höhe. Nach den Feststellungen des Oberlandesgerichs Hamm ist die zwischen den Parteien im Ingenieurvertrag getroffene Pauschalhonorarvereinbarung nach nationalem Recht unwirksam, weil sie das sich bei Anwendung der Mindestsätze ergebende Honorar unterschreitet, ohne dass ein Ausnahmefall gemäß § 7 Abs. 3 HOAI vorliegt. Das Ingenieurbüro kann danach von der Auftraggeberin das Mindestsatzhonorar, dessen Berechnung der Höhe nach nicht angegriffen ist, abzüglich bereits geleisteter Zahlungen verlangen.
Die hiergegen gerichteten Einwände der Auftraggeberin, die sich unter anderem auf einen Verstoß des Klägers gegen Treu und Glauben gemäß § 242 BGB berufen hat, greifen nicht durch. Der Bundesgerichtshof hat insoweit auf seine Ausführungen im Aussetzungs- und Vorlagebeschluss vom 14.05.2020[7] Bezug genommen, von denen abzuweichen kein Anlass besteht. Ergänzend hierzu hat er in seinem jetezt verkündeten Urteil darauf hingewiesen, dass die Geltendmachung eines Anspruchs durch eine Partei insbesondere nicht deshalb gemäß § 242 BGB als treuwidrig und damit unzulässig bewertet werden kann, weil die nationale Rechtsvorschrift, aus der der Anspruch hergeleitet wird, gegen eine Richtlinie der Europäischen Union verstößt. Eine Partei kann sich vielmehr grundsätzlich auf eine nationale Rechtsvorschrift berufen, solange diese weiterhin gültig und im Verhältnis der Parteien anwendbar ist. Das von der Rechtsprechung entwickelte Rechtsinstitut der unzulässigen Rechtsausübung ist nur dann einschlägig, wenn die Anwendung einer Rechtsvorschrift einen im Einzelfall bestehenden Interessenkonflikt ausnahmsweise nicht hinreichend zu erfassen vermag und für einen Beteiligten ein unzumutbares unbilliges Ergebnis zur Folge hätte. Es dient jedoch nicht dazu, eine vom nationalen Gesetzgeber mit einer Rechtsvorschrift getroffene Wertung generell durch eine andere Regelung zu ersetzen.
Eine richtlinienkonforme Auslegung des § 7 HOAI unter Berücksichtigung der im Vertragsverletzungsverfahren ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 04.07.2019[6] führt, wie der Bundesgerichtshof ebenfalls bereits in seinem Vorlagebeschluss[7] im Einzelnen ausgeführt hat, gleichfalls nicht zum Erfolg der Revision der Auftraggeberin. § 7 HOAI kann nicht richtlinienkonform dahin ausgelegt werden, dass die Mindestsätze der HOAI im Verhältnis zwischen Privatpersonen grundsätzlich nicht mehr verbindlich sind und daher einer die Mindestsätze unterschreitenden Honorarvereinbarung nicht entgegenstehen.
Nach dem nunmehr im Vorabentscheidungsverfahren ergangenen Urteil des Unionsgerichtshofs vom 18.01.2022[3] steht fest, dass der Bundesgerichtshof im Streitfall nicht aufgrund Unionsrechts verpflichtet ist, das verbindliche Mindestsatzrecht der HOAI unangewendet zu lassen. Der EuGH hat insoweit festgestellt, dass der Dienstleistungsrichtlinie eine unmittelbare Wirkung in einem Rechtsstreit zwischen Privatpersonen – wie hier – nicht zukommt. Die betreffende Richtlinie steht der Anwendung der verbindlichen Mindestsätze daher nicht entgegen. Der EuGH hat ferner ausgeführt, dass die zuständigen nationalen Gerichte nicht allein aufgrund eines im Vertragsverletzungsverfahren erlassenen Urteils verpflichtet sind, im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Privatpersonen eine nationale Regelung, die gegen die Bestimmung einer Richtlinie verstößt, unangewendet zu lassen.
Europäisches Primärrecht in Form der Niederlassungsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit oder sonstige allgemeine Grundsätze des Unionsrechts stehen der Anwendung der in der HOAI verbindlich geregelten Mindestsätze im Streitfall ebenfalls nicht entgegen. Der EuGH hat insoweit klargestellt, dass die Bestimmungen des AEUV über die Niederlassungsfreiheit, den freien Dienstleistungsverkehr und den freien Kapitalverkehr auf einen Sachverhalt, dessen Merkmale nicht über die Grenzen eines Mitgliedsstaates hinausweisen, grundsätzlich keine Anwendung finden. Da der vorliegende Rechtsstreit durch Merkmale charakterisiert sei, die sämtlich nicht über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinauswiesen, könne ohne die Angabe eines Anknüpfungspunktes bezüglich der Vorschriften des Unionsrechts betreffend die Grundfreiheiten durch das vorlegende nationale Gericht nicht davon ausgegangen werden, dass das entsprechende Ersuchen um Auslegung für die Entscheidung des Rechtsstreits erforderlich sei. Wenngleich der EuGH die diesbezügliche Vorlagefrage des Bundesgerichtshofs deshalb als unzulässig beschieden hat, steht danach fest, dass die betreffenden Grundfreiheiten oder sonstige allgemeine Grundsätze des Unionsrechts der Anwendung der in der HOAI verbindlich geregelten Mindestsätze im Streitfall nicht entgegenstehen. Über die sich bereits aus dem Vorabentscheidungsersuchen vom 14.05.2020[7] ergebenden Ausführungen hinaus sind keine Anknüpfungspunkte bezüglich der Vorschriften des Unionsrechts betreffend die Grundfreiheiten oder sonstige allgemeine Grundsätze des Unionsrechts festzustellen. Veranlassung für ein erneutes Vorabentscheidungsersuchen an den Unionsgerichtshof besteht daher nicht.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 2. Juni 2022 – VII ZR 174/19
- EuGH, Urteil vom 04.07.2019 C377/17[↩][↩]
- BGH – Beschluss vom 14.05.2020 – VII ZR 174/19[↩]
- EuGH, Urteil vom 18.01.2022 – C261/20 – Thelen Technopark Berlin[↩][↩]
- LG Essen, Urteil vom 28.12.2017 – 6 O 351/17[↩]
- OLG Hamm, Teilverzichts- und Schlussurteil vom 23.07.2019 – 21 U 24718, BauR 2019, 1810[↩]
- EuGH, Urteil vom 04.07.2019 – C377/17 – Kommission/Deutschland[↩][↩]
- BGH, Beschluss vom 14.05.2020 – VII ZR 174/19[↩][↩][↩]