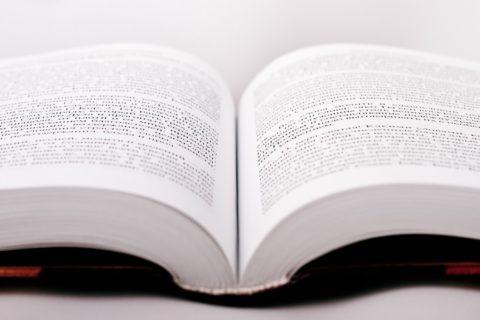Nach § 2 Nr. 3 HwO gelten die Vorschriften der Handwerksordnung auch für handwerkliche Nebenbetriebe, die mit einem Unternehmen eines zulassungspflichtigen Handwerks, der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft oder sonstiger Wirtschafts- und Berufszweige verbunden sind.

Ein handwerklicher Nebenbetrieb liegt nach § 3 Abs. 1 HwO vor, wenn in ihm Waren zum Absatz an Dritte handwerksmäßig hergestellt oder Leistungen für Dritte handwerksmäßig bewirkt werden, es sei denn, dass eine solche Tätigkeit nur in unerheblichem Umfang ausgeübt wird, oder dass es sich um einen Hilfsbetrieb handelt. Nach § 3 Abs. 2 HwO ist eine Tätigkeit unerheblich, wenn sie während eines Jahres die durchschnittliche Arbeitszeit eines ohne Hilfskräfte Vollzeit arbeitenden Betriebs des betreffenden Handwerkszweigs nicht übersteigt.
Die Vorschrift des § 3 Abs. 1 HwO definiert den handwerklichen Nebenbetrieb nicht abschließend. Aus einer Zusammenschau dieser Vorschrift mit § 2 Nr. 2 und 3 HwO ergibt sich, dass der handwerkliche Nebenbetrieb immer mit einem anderen Unternehmen verbunden sein muss. Dabei müssen die Inhaber beider Betriebe zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht identisch sein und die Betriebe in einer bestimmten wirtschaftlichen, organisatorischen und fachlichen Beziehung zueinander stehen[1]. Kennzeichnend für einen handwerklichen Nebenbetrieb ist, dass er mit einem anderen Betrieb, dem Hauptbetrieb, verbunden ist. Der zu fordernde wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Haupt- und Nebenbetrieb liegt vor, wenn der Nebenbetrieb den wirtschaftlichunternehmerischen Zwecken des Hauptunternehmens dient und seine Erzeugnisse oder Leistungen dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit und den Gewinn des Hauptbetriebes zu steigern[2]. Ferner wird eine gewisse Selbständigkeit vorausgesetzt[3]. Beispielsweise können die für Dritte bewirkten Leistungen einer Kfz-Reparaturwerkstatt die für das Vorliegen eines handwerklichen Nebenbetriebes erforderliche fachliche Verbundenheit mit einer Tankstelle erfüllen, wenn diese Leistungen vom wirtschaftlichen Standpunkt; und vom Interesse der Kunden her gesehen eine sinnvolle Ergänzung und Erweiterung des Leistungsangebots der Tankstelle darstellen[4].
Insbesondere steht der Umstand, dass der Handwerke im zweiten Betrieb identische Leistungen erbringt wie an seinem Unternehmenssitz, der Annahme entgegen, er unterhalte dort einen zu seinem Unternehmenssitz gehörigen Nebenbetrieb.
Dabei kann offen bleiben, ob es für die Annahme eines Nebenbetriebs erforderlich ist, dass eine räumliche Verbindung zum Hauptbetrieb besteht[5]. In einem Nebenbetrieb werden jedenfalls nicht dieselben Leistungen wie im Hauptbetrieb erbracht, sondern Tätigkeiten, die die Leistungen des Hauptbetriebs sinnvoll ergänzen und erweitern[6].
Die Annahme eines Nebenbetriebes im Sinne von § 2 Nr. 3 und § 3 Abs. 2 HwO setzt jedoch eine wirtschaftliche Verbundenheit zwischen Haupt- und Nebenbetrieb voraus, die darin besteht, dass der Nebenbetrieb den wirtschaftlichunternehmerischen Zwecken des Hauptunternehmens dient.
Die Handwerksordnung schließt nicht aus, dass ein Handwerk an mehreren Orten betrieben wird. Nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt ist die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Handwerker in derartigen Fällen dem Gebot der Meisterpräsenz unterliegt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Zweigstelle für sich betrachtet einen Handwerksbetrieb im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 HwO darstellt und dort oder von dort aus Aufträge für handwerkliche Arbeiten entgegengenommen und ausgeführt sowie die fertiggestellten Werke ausgeliefert werden[7]. Andererseits sind ein bloßes Materiallager, eine Auftragsannahmestelle, eine Stelle zur Organisation des Arbeitseinsatzes und eine reine Verkaufsstelle nicht als hinreichend eigenständig in diesem Sinne anzusehen, weil solche Organisationsteile nicht für sich betrachtet – die Merkmale eines Handwerksbetriebes erfüllen[8].
Allerdings ist bei der Prüfung, ob eine handwerkliche Zweigstelle vorliegt, nicht darauf abzustellen, ob die weitere Betriebsstätte die Voraussetzungen einer Zweigniederlassung im Sinne des § 14 GewO erfüllt. Auch die übrige innere Organisation des Unternehmens mit Zweigstellen ist nicht ausschlaggebend. Deswegen hindern die wirtschaftliche Abhängigkeit sowie die Erledigung der kaufmännischen und personellen Angelegenheiten durch den Hauptbetrieb die erforderliche Eigenständigkeit der Zweigstelle nicht. Weiter kommt es nicht darauf an, ob die Zweigstelle bei Fortfall des Hauptbetriebes ohne die vom Hauptbetrieb erledigten Tätigkeiten als eigener Handwerksbetrieb fortbestehen könnte, insbesondere ob sie über eine ausreichende wirtschaftliche Grundlage verfügen würde. Unerheblich ist schließlich, ob die Zweigstelle aufgrund von Verträgen, die die Zentrale geschlossen hat, nur für bestimmte Kunden tätig wird[9]. Der Umstand, dass der genutzte Raum nicht den Eindruck eines voll ausgestatteten Geschäftslokals vermittelt, ist daher ohne Bedeutung.
Es kommt auch nicht darauf an, ob sich die beiden Betriebe im Bezirk derselben Handwerks- kammer oder in Bezirken unterschiedlicher Handwerkskammern befinden. Entscheidend ist, ob der Betriebsleiter innerhalb weniger Minuten vor Ort sein kann.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 16. Juni 2016 – I ZR 46/15
- NdsOVG, GewArch 1993, 422; VGH Bad.-Württ., GewArch 1993, 74; BayObLG, GewArch 1993, 424[↩]
- BGH, Urteil vom 11.07.1991, GRUR 1992, 123, 125 = WRP 1991, 785 – Kachelofenbauer II[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 06.08.1996 – 1 B 38/96, Buchholz 451.45 § 2 HwO Nr. 9[↩]
- BVerwG, Urteil vom 19.08.1986 – BVerwG 1 C 2.84, Buchholz 451.45 § 2 HwO Nr. 7[↩]
- vgl. dazu Honig/Knörr aaO § 3 Rn. 2 mwN[↩]
- BVerwG, Buchholz 451.45 § 2 HwO Nr. 7; BayObLG, NVwZ 1983, 701; OLG Düsseldorf, GewArch 1983, 269[↩]
- vgl. BVerwGE 95, 363, 366[↩]
- BVerwGE 95, 363, 366[↩]
- BVerwGE 95, 363, 367[↩]