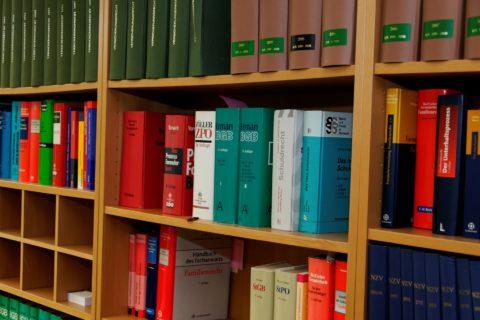Eine Nachfrist zur Sicherheitsleistung kann gemäß § 648a Abs. 5 Satz 1, § 643 Satz 1 BGB erst dann wirksam gesetzt werden, wenn die Frist zur Sicherheitsleistung, § 648a Abs. 1 BGB, fruchtlos abgelaufen ist.

Nach § 648a Abs. 1 BGB a.F. kann der Unternehmer eines Bauwerks vom Besteller Sicherheit für die von ihm zu erbringenden Vorleistungen in der Weise verlangen, dass er dem Besteller zur Leistung der Sicherheit eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmt, er verweigere nach dem Ablauf der Frist die Leistung. Leistet der Besteller die Sicherheit nicht fristgemäß, so bestimmen sich die Rechte des Unternehmers gemäß § 648a Abs. 5 Satz 1 a.F. nach §§ 643 und 645 Abs. 1 BGB. Nach § 643 Satz 1 BGB ist der Unternehmer berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Sicherheitsleistung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den Vertrag kündige, wenn die Sicherheit nicht bis zum Ablauf der Frist geleistet wird. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablauf der Frist erfolgt.
Ein Bauvertrag wird daher regelmäßig nicht dadurch aufgehoben, dass der Bauunternehmer mit dem Verlangen nach Sicherheit gleichzeitig eine Nachfrist setzt und diese Frist fruchtlos abgelaufen ist. Denn diese Nachfrist ist nicht wirksam gesetzt worden. Eine Nachfrist zur Sicherheitsleistung kann gemäß § 648a Abs. 5 Satz 1 a.F., § 643 Satz 1 BGB erst dann wirksam gesetzt werden, wenn die Frist zur Sicherheitsleistung, § 648a Abs. 1 BGB a.F., fruchtlos abgelaufen ist.
Der Wortlaut und die Systematik des Gesetzes sind insoweit eindeutig. Danach bestimmen sich die Rechte des Unternehmers erst dann aus § 643 BGB, wenn der Besteller die Sicherheit nicht fristgemäß geleistet hat. Folglich kann der Unternehmer erst dann eine Nachfrist setzen, wenn die Frist zur Sicherheitsleistung abgelaufen ist. Nichts anderes ergibt sich aus der Begründung zum Entwurf des Bauhandwerkersicherungsgesetzes. Danach kann der Unternehmer sich zunächst durch Verweigerung der Vorleistung vor wirtschaftlichen Nachteilen schützen, § 648a Abs. 1 BGB a.F. Ihm soll jedoch die Möglichkeit gegeben werden, mit dem Vorgehen nach § 643 BGB einen Schwebezustand zu beseitigen, der eintritt, wenn die Sicherheit nicht innerhalb der zunächst gesetzten Frist geleistet wird. Es spricht nach diesen Erwägungen nichts dafür, dass der Unternehmer bereits in einem Zeitpunkt, in dem nicht feststeht, ob der Schwebezustand überhaupt eintritt und ob und wie er ihm entgegentreten will, bereits eine Nachfrist setzen können soll.
Damit ist die Auffassung abzulehnen, eine Nachfrist könne bereits mit dem Sicherungsverlangen gesetzt werden. Es trifft nicht zu, dass dem Besteller keine Nachteile entstehen, wenn ihm sofort eine Nachfrist gesetzt wird. Denn die Nachfrist wird in einem Zeitpunkt gesetzt, in dem überhaupt noch nicht feststeht, ob ein Schwebezustand eintritt. Sie hat deshalb wegen ihrer fiktiven Voraussetzungen eine deutlich schwächere Warnfunktion als die Nachfrist, die erst dann gesetzt wird, wenn feststeht, dass der Unternehmer berechtigt ist, die Leistung zu verweigern. Unergiebig ist auch die Bezugnahme des Berufungsgerichts auf die Rechtsprechung zu der Möglichkeit, eine Frist mit Ablehnungsandrohung nach § 326 Abs. 1 BGB a.F. gleichzeitig mit der Mahnung zu verbinden. Denn mit der Mahnung tritt der Verzug ein, so dass die Voraussetzungen des § 326 Abs. 1 BGB a.F. vorliegen, wenn dem Schuldner die Mahnung zugeht und gleichzeitig die Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung. Anders ist es aber, wenn eine Nachfrist voraussetzt, dass zuvor eine andere Frist abgelaufen ist. So ist es nach der Systematik des § 648a Abs. 5 Satz 1 BGB a.F. in Verbindung mit § 643 Satz 1 BGB. Diese gesetzliche Systematik kann nicht zum Nachteil des Bestellers durch vermeintliche Billigkeitserwägungen ersetzt werden.
Zusätzlich weist der Bundesgerichtshof aber auch noch darauf hin, dass bei der Prüfung, ob eine angemessene Frist zur Sicherheitsleistung gesetzt worden ist, auch in die Erwägung einfließen muss, ob die Rechtslage klar ist. Ist eine unklare Rechtslage etwa dadurch geschaffen worden, dass der Unternehmer sich weigert, nach dem Vertrag noch geschuldete Vorleistungen ohne zusätzliche Vergütung zu erbringen, und die Höhe der Sicherheit mangels verlässlicher Angaben in der Anforderung der Sicherheit noch durch den Besteller ermittelt werden muss, kann es geboten sein, eine längere Frist zu setzen. Bei der Fristsetzung muss berücksichtigt werden, dass in einem solchen Fall möglicherweise eine anwaltliche Beratung notwendig ist. Auch muss darauf Rücksicht genommen werden, dass die Beschaffung einer Bürgschaft jedenfalls nicht an Wochenenden möglich ist und auch nicht an einem Feiertag, der in die Frist fällt. Bleiben danach, wie hier, nur fünf Werktage, dürfte eine Frist zur Stellung einer Sicherheit nach § 648a BGB, wenn keine anderweitige Ankündigung des Sicherungsverlangens vorausgegangen ist, regelmäßig zu kurz sein.
Hinzuweisen ist auch darauf, dass eine endgültige Leistungsverweigerung regelmäßig auch dann vorliegt, wenn der Unternehmer nur noch bereit ist, geschuldete Leistungen gegen zusätzliche Vergütung zu erbringen. Stehen nur noch diese Leistungen als Vorleistungen aus, ist das Sicherungsverlangen unberechtigt.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 20. Dezember 2010 – VII ZR 22/09