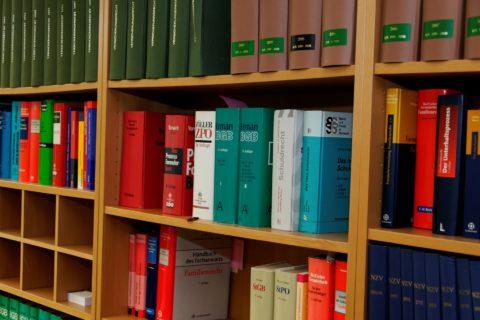Vom Auftraggeber gestellte Allgemeine Geschäftsbedingungen, nach denen die anrechenbaren Kosten für Leistungen der Leistungsphasen 2 bis 4 gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure auf der Grundlage einer genehmigten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage Bau zu bestimmen sind, sind wegen unangemessener Benachteiligung des Architekten unwirksam.

Dies entschied der Bundesgerichtshof hier zu einem Vertrag, der zeitlich noch der Geltung des § 9 AGBG unterfiel.
Darin liegt eine vorweggenommene Beweiswürdigung, die im Prozessrecht keine Stütze findet. Eine etwaige Widersprüchlichkeit des Parteivortrags kann regelmäßig nur im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden[1].
Die hier im Streit stehenden Regelungen enthalten mittelbar ein solches einseitiges Leistungsbestimmungsrecht. Sie räumen dem Auftraggeber abweichend von § 10 Abs. 2 HOAI a.F. und § 69 Abs. 3 HOAI a.F. das Recht ein, im Rahmen des für die Kostenberechnung vorgeschriebenen Genehmigungsverfahrens über die Höhe der der Honorarermittlung zugrunde zu legenden anrechenbaren Kosten für die Leistungsphasen 2 bis 4 und damit über die Höhe des Honorars einseitig zu entscheiden.
Zudem werden Umfang und Grenzen dieses Rechts nicht festgelegt.
Dies stellt eine unangemessene Benachteiligung des Architekten dar. Der Auftraggeber, der regelmäßig ein Interesse daran hat, das Honorar möglichst niedrig zu halten, kann nach Vertragsschluss und (teilweiser) Leistungserbringung seitens des Architekten durch einseitige Abänderung der sich aus der Kostenberechnung ergebenden anrechenbaren Kosten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erheblichen Einfluss auf die Höhe des Honorars nehmen.
Der Architekt hat demgegenüber auf das Genehmigungsverfahren keine Einflussmöglichkeit und muss dessen Ergebnis nach dem Wortlaut der Klauseln hinnehmen.
Das begründet die Gefahr, dass das Honorar in unangemessener, den Leistungen des Architekten nicht gerecht werdender Weise reduziert werden kann. Berechtigte Belange des Auftraggebers, die eine solche einseitig zu Lasten des Architekten gehende Klausel rechtfertigen könnten, sind nicht erkennbar.
Die Regelungen Ausrüstung sind daher als Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam, ohne dass es darauf ankommt, ob ihre Anwendung im Einzelfall zu einer nach § 4 HOAI a.F. unzulässigen Mindestsatzunterschreitung geführt hat[2].
Nichts anderes folgt aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 09.02.2012[3] sowie aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16.12 2004[4]. In beiden Entscheidungen hatte sich der Bundesgerichtshof nicht mit der Frage einer Unwirksamkeit nach §§ 9 ff. AGBG auseinanderzusetzen. Der Bundesgerichtshof hat an keiner Stelle ausgeführt, dass eine Unwirksamkeit nach §§ 9 ff. AGBG von Vertragsklauseln, die die Honorarberechnungsparameter betreffen, nur dann in Betracht kommt, wenn hierdurch im Einzelfall die Mindestsätze unterschritten werden.
Dagegen betont der Bundesgerichtshof, dass zum Zwecke der Honorarberechnung eine am Ende der Entwurfsplanung erstellte Kostenberechnung nicht fortzuschreiben ist. Der Bundesgerichtshof hat eine Fortschreibung des Kostenanschlags zu diesem Zweck im Anwendungsbereich der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 17.09.1976[5] in der Fassung der Fünften Änderungsverordnung vom 21.09.1995[6] abgelehnt. Er hat hierzu unter anderem ausgeführt, dass das Honorar von den anrechenbaren Kosten abhängt, die nach dem jeweiligen Planungsstand den Kostenermittlungen zugrunde zu legen sind. Änderungen dieses Planungsstandes können deshalb grundsätzlich nicht mehr zu einer Änderung der honorarrechtlich maßgeblichen Kostenermittlung führen. Kostenveränderungen, die dadurch entstehen, dass nach einer Kostenermittlung die Planung verfeinert wird, finden bei der Honorierung grundsätzlich erst in der nächsten Kostenermittlung Berücksichtigung. Sofern der Architekt im Zusammenhang mit Nachträgen erneute Grundleistungen erbringen muss, steht ihm jedoch gegebenenfalls ein weiteres Honorar hierfür zu[7]. Diese Grundsätze gelten hinsichtlich der Frage einer Fortschreibung der Kostenberechnung im Anwendungsbereich der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in den hier maßgebenden Fassungen entsprechend.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 16. November 2016 – VII ZR 314/13
- vgl. BGH, Urteil vom 13.03.2012 – II ZR 50/09, NJW-RR 2012, 728 Rn. 16; Beschluss vom 21.07.2011 – IV ZR 216/09, VersR 2011, 1384 Rn. 6; jeweils m.w.N.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 09.07.1981 – VII ZR 139/80, BGHZ 81, 229, 236 f. 25 ff.; KG, BauR 1991, 251, 254; Becker, BauR 1991, 255 f.; Locher, BauR 1986, 643, 644; Osenbrück, Die RBBau, 4. Aufl., VM § 6 Rn. 29[↩]
- BGH, Urteil vom 09.02.2012 – VII ZR 31/11, BGHZ 192, 305[↩]
- BGH, Urteil vom 16.12 2004 – VII ZR 16/03, BauR 2005, 735 = NZBau 2005, 285[↩]
- BGBl. I S. 2805[↩]
- BGBl. I S. 1174[↩]
- BGH, Urteil vom 05.08.2010 – VII ZR 14/09, BauR 2010, 1957 Rn. 16, 20 = NZBau 2010, 706; vgl. auch Fuchs/Seifert in FBS, HOAI, 2016, § 10 HOAI Rn. 9, 34 f. m.w.N.; Löffelmann/Fleischmann, Architektenrecht, 6. Aufl. Rn. 1047a ff.; Preussner, NJW 2011, 1713, 1715[↩]